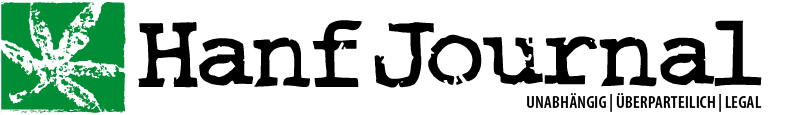Gutes Buch – schlechtes Nachwort

Der Diogenes Verlag bringt momentan die Werke des meines Erachtens stark unterschätzten Schriftstellers Jörg Fauser in einer neuen Edition heraus. Das ist eine wichtige und gute Aufgabe, denn Fauser ist einer der wichtigsten deutschen Nachkriegsschriftsteller. Fauser war ein großer Freund der berauschenden Substanzen. Er kiffte gerne, obwohl dies für ihn wohl eher lediglich schmückendes Beiwerk war. Fauser verschrieb sich für etliche Jahre seines Lebens wohl mit jeder Faser den Opiaten in all seinen Existenzformen. Sucht, Beschaffungskriminalität und das Schriftstellertum gingen dabei lange Hand in Hand. Heute nehmen wir uns sein Werk „Das Schlangenmaul“ vor, das überwiegend in Berlin spielt. Vorneweg: Obwohl das „Schlangenmaul“ eines seiner weniger ambitionierten literarischen Werke ist, verspricht es dennoch Lesevergnügen vom Feinsten. Fauser hat dieses Werk mit recht konventionellen stilistischen Mitteln und gängigen Inhalten garniert, um endlich im Mainstream des deutschen Literaturbetriebs anzukommen und um seine Kritiker*innen zum Verstummen zu bringen. Obwohl im „Schlangenmaul“ kein einziger Joint explizit geraucht wird, schwingen Cannabis und Haschisch die ganze Zeit zwischen den Zeilen mit. Denn in den im Roman beschriebenen Räume wie Baghwan, Kunstbetrieb und rotlichtdurchflutete Randzonen der Gesellschaft, gibt es ausreichend THC-haltigen Rauch. Das hat Fauser gewusst und dieses Wissen bei seinen Leser*innen vorausgesetzt. Insofern hielt er es wohl nicht für nötig, explizit darauf einzugehen. Dasselbe gilt auch für viele andere Drogen wie Koks und Opiate. Wer den Kriminalroman gelesen hat, wird meinen Aussagen vermutlich unweigerlich zustimmen.
Zum Inhalt: Der Protagonist, Heinz Harder, ist 38 Jahre alt, Journalist und vor allem dauerpleite. Das Finanzamt sitzt Harder unerbittlich im Nacken und deshalb bietet er per Anzeige seine Dienste als ein „Bergungsexperte für außergewöhnliche Fälle“ an. Bald erhält er auch seinen ersten Auftrag: Nora Schäfer-Scheunemann aus Hannover sucht ihre verschwunden gegangene achtzehnjährige Tochter. Die Spuren führen Harder in das wilde West-Berlin der 80er Jahre, wo Harder äußerst windige Geschäftemacher trifft und dubiose Politik- und Finanzmachenschaften aufdeckt und schließlich zu einer mysteriösen Schlangen-Sekte findet – eine Art von Sekte, wie sie wohl in den 80er Jahren nichts Besonderes war und ständig vorkam. Harder, der eine Mischung aus Journalist, Detektiv und Ritter ist, will den Fall lösen und kommt dem Schlangenmaul dabei gefährlich nahe.
So gut der Roman ist, so sehr enttäuscht das Nachwort. Leider ist das Nachwort des durchaus renommierten deutschen Schriftstellers Friedrich Ani sehr durchwachsen und trübt nach der Lektüre des „Schlangenmauls“ das gesamte Lese-Erlebnis. Nach der Lektüre des Nachworts bleibt man etwas ratlos zurück. Auf knapp vier Buchseiten präsentiert der Nachwort-Autor ein Sammelsurium an Eindrücken, Feststellungen und Behauptungen über Fauser und sein Werk, das weder stringent noch sonderlich durchdacht wirkt. Mal ein Beispiel, das sicherlich intellektuell sehr anspruchsvoll wirken soll, aber nicht nur eingefleischte Fauser-Fans dann doch perplex zurücklässt: „Kant, ein Hard-Boiled-Meisterwerk über die banale Verlogenheit der Welt und die sagenhaften Selbstverstrickungsfähigkeiten des Menschen, mit einem fauserschen Helden im Strudel des Geschehens, der seinen Bauchnabel längst der Nachwelt der Innenwelt der Außenwelt der Innenwelt vermacht hätte.“ Bereits das Wort Selbstverstrickungsfähigkeiten hätte Fauser sicherlich dazu verleitet, zu einem Bier oder einem bevorzugten Beruhigungsmittel seiner Wahl zu greifen, aber nach der Lektüre des ganzen Satzes hätte er vermutlich verzweifelt die Fixe gesucht – ein Joint hätte an dieser Stelle nicht mehr gereicht. Woher Ani die Berechtigung nimmt, Fauser in die Folge des schwedischen Autorenpaares Sjöwall/Wahlöö zu stellen, wird wohl auf immer sein Geheimnis bleiben, zumindest schweigt er sich im Nachwort ausführlich darüber aus. Aber auch eigentlich einfach zu begründende Behauptungen bleiben ohne Anbindungen im Raum stehen und regen zu Recht Fragen an, wieso sich das denn so verhalte: „Fausers Bücher nach mehr als dreißig Jahren wieder zu lesen … führte bei mir zu einem enormen Glücksschub. Sensationell, wie er dem flatterigen, ebenso desillusionierten wie von professioneller Neugier getriebenen Investigativjournalisten Heinz Harder die Aura eines geradezu klassischen Privatdetektivs verpasst“.
Wie sich der besagte Glücksschub ergibt, wie er sich konkret äußert und was sensationell daran sein soll, enthält uns der Autor leider (oder vielleicht auch zum Glück – man möchte und muss schließlich nicht alles wissen) vor. Insofern war das Nachwort vielleicht gut gemeint, indem mit Ani ein bekannter deutscher Schriftsteller bemüht wurde, der sicherlich auch für den Absatz des einen oder anderen Zusatzexemplars des „Schlangenmauls“ sorgen sollte. Doch das Nachwort ist wie gesagt leider in der Summe so konfus, dass es mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen produziert und damit seinen Sinn geradezu konterkariert. Entweder hatte Ani die Aufgabe das Nachwort zu verfassen aus rein materiellen Gründen angenommen, um sich damit besser in die Position Harders reinversetzen zu können, und er hat dann diesen Berg irgendwie abgearbeitet, oder aber der Diogenes Verlag hat sich herausgenommen, das Nachwort „mitzugestalten“, was dann kräftig nach hinten losgegangen wäre. Aber ein durchweg missglücktes Nachwort ändert zum Glück nichts an Fausers Schlangenmaul! Das ist nach wie vor ein Werk von grandiosem Wert und sei hiermit ausdrücklich zur Lektüre empfohlen. Auch der Konsum von dem, was im Werk nicht explizit mitschwingt, dürfte das Lesevergnügen keineswegs schmälern.
Christian Rausch