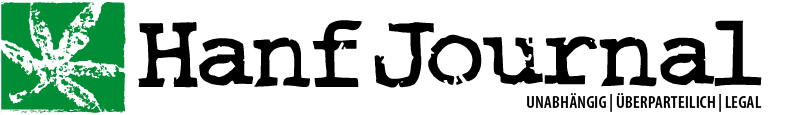Der rebellische Bayaman
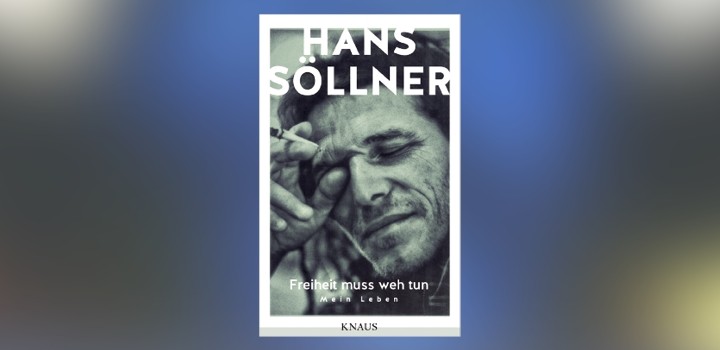
Hans Söllner ist bei Kiffern – wie sollte es anders sein – sehr beliebt. Das steht ganz außer Frage. Er gilt sogar als Vorkämpfer für das selbstbestimmte Recht auf Marihuana-Konsum und als Stilikone für all diejenigen, die nicht nur klammheimlich abends zu Hause einen Joint rauchen, sondern dies offiziell zelebrieren wollen. Jetzt ist im Penguin Verlag (das neue Flagship-Label von Randomhouse) seine Autobiografie „Freiheit muss weh tun“ erschienen. Einmal mehr ein Grund sich mit dieser schillernden Künstlerfigur und dem Marihuana-Aktivisten zu beschäftigen.
Söllner wurde 1955 in Bad Reichenhall geboren und ist für seine gesellschafts- und systemkritischen Texte in bayrischer Mundart bekannt. Während er früher als Liedermacher mit Gitarre, Mundharmonika und den besagten Texten reüssierte, spielt er seit einigen Jahren mit seiner Band auch eine Form des bayrischen Reggaes.
„Freiheit muss weh tun“ ist mehr als nur eine durchschnittliche Autobiografie. Sie ist Selbstbekenntnis, Selbsterkenntnis und eine Art Schelmenroman zugleich. In bewusst einfacher Sprache, die an den Schelmenroman „Simplicius Simplicissimus“ von Grimmelshausen erinnert, beschreibt Söllner die Kindheit in einem einfachen und nicht sonderlich glücklichen Elternhaus und Arbeiterhaushalt. Schlimm lasten die Erinnerungen auf ihm, dass sich Vater und Mutter häufig gestritten haben. Im Gegensatz zu anderen Familienmitgliedern fürchtete er sich aber nicht vor den heftigen Streitereien, sondern vertrat immer feste und bestimmt seine Meinung – ein Merkmal, das sich durch sein Leben zieht wie ein roter Faden. Es folgten eine unstete Jugend mit Ausbildungen zum Koch und Automechaniker.
Eher beiläufig gelangte Söllner zur Musik. Er brachte sich das Gitarre- und später das Mundharmonikaspielen bei. Zwar hatte Söllner bereits früh Kontakt zu Haschisch und Gras, da er immer wieder Freundinnen aus dem akademischen Milieu hatte, in dem diese Drogen gängig waren. Er selbst kiffte aber zunächst nicht. In „Freiheit muss weh tun“ bestätigt er, dass er die ersten Lieder über Marihuana dichtete, bevor er es selbst überhaupt getestet hatte. Wow, das stand so eigentlich nicht zu vermuten. Der Erfolg ließ zum Glück nicht allzu lange auf sich warten. Söllner wurde zur bekannten bayrischen Szene-Größe und seine Auftritte in Wirtshäusern wurden immer mehr zum Geheimtipp. Bald reihte sich ein Gig an den anderen und Söllner stellte fest, dass er als Liedermacher und Sänger finanziell besser über die Runden kam, als Automechaniker.
Also musste er irgendwann die folgenschwere Entscheidung zwischen bürgerlich-spießigem Lebenswandel als Automechaniker und dem freiheitlich-libertären Dasein als freier Künstler treffen. Natürlich fiel ihm die Wahl für die zweite Option nicht allzu schwer, zumal sich mit der Entscheidung für die Kunst ein missionarisches Sendungsbewusstsein verband. Dieses hatte einen handfesten Hintergrund, denn inzwischen hatte Söllner seine Liebe zu Thc-haltigen Naturprodukten entdeckt.
Offen und ehrlich schildert er, dass den meisten Verdruss in seinem Leben ihm die Liebesgeschichten bereitet haben. Und aufgrund einer unglücklich endenden Liebesbeziehung kamen auf Söllner die Erfahrungen seines ersten Jamaika-Trips zu. Wer die liest, staunt zunächst nicht schlecht. Denn Söllner lässt beinahe kein gutes Haar an der Karibik-Perle, die doch gerade für eingefleischte Kiffer das Sahnehäubchen ist. Doch Söllner kam nicht zurecht, er wurde bestohlen, hatte Probleme sich vernünftiges Gras zu fairen Preisen zu kaufen und fühlte sich auf der Insel unsicher. In der Retrospektive erklärt er sich das damit, dass er eben noch nicht reif genug für den Karibikstaat gewesen sei. Seine zahlreichen späteren Besuche auf Jamaika lassen beinahe keinen anderen Schluss übrig, denn jetzt geht Söllner hier voll in seinem Element auf.
Mit Jamaika verbindet sich noch die Religion, denn Söllner trat aus der katholischen Kirche aus, nahm irgendwann einmal für sich die Religion der Rastafari an und verschrieb sich von da an dem Kampf für die Legalisierung von Marihuana. Doch wer Bayern kennt, der weiß, mit welchen Windmühlen man es dort aufnehmen muss und wie sinnlos das Unterfangen an sich ist. Je erfolgreicher Söllner als Künstler wurde, desto massiver legte er sich mit der bayrischen Justiz und den Exekutivorganen an. Das entwickelte sich zu einem veritablen Katz- und Mausspiel. Denn Söllner provozierte die Staatsmacht ganz bewusst und mit einer alternierenden Taktik von großen und kleinen Nadelstichen.
Was folgte waren zahllose Anzeigen, Anklagen und Gerichtsverfahren gegen ihn wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Als diese juristischen Auseinandersetzungen zunehmen, verändert sich auch der Ton in „Freiheit muss weh tun“. War der Stil bis dahin eher kunstvoll einfach und beinahe einfältig gehalten, so wird er jetzt „erwachsener“ und angespannter. Ohne Bitterkeit aber voller Intensität beschreibt Söllner, wie er bewusst die juristischen Auseinandersetzungen gesucht hat, um im Lichte der Öffentlichkeit für die Legalisierung von Marihuana zu kämpfen.
Was folgte war Repression pur. Minutiös und durchaus spannend beschreibt Söllner, wie er von der bayrischen Polizei stark drangsaliert wurde. Endlose Male wurde er auf dem Weg zu und von Konzerten von den Uniformierten angehalten, akribisch durchsucht und eingehenden Überprüfungen unterzogen. Als sich dieses übergriffige Staatsverhalten auch auf seine Fans übertrug, hatte der Künstler genug. Er forderte öffentlich seine Anhänger auf, kein Marihuana auf seine Konzerte mitzubringen, da die Gefahr von der Polizei angehalten, durchsucht und erwischt zu werden, zu groß sei. Aber was für ein Paradoxon! Da geht man auf ein Konzert eines Liedermachers, der für seine Lieder über Gras bekannt ist und darf nichts kiffen? Eben, beinahe ein No Go.
Söllner selbst focht tapfer seine Streitereien mit der bayrischen Justiz aus. Immer wieder gelang es ihm, den Gerichtssaal zu seiner Bühne zu machen. Dabei stellte er dann das Justiz- und Polizeisystem und ihren verbissenen, sinnlosen Kampf gegen den Missbrauch Thc-haltiger Produkte bloß. Nicht selten erschien ein Teil von Söllners Fanbase zu den Gerichtsterminen und unterstützte ihn lautstark, was die Gerichtsverhandlungen mitunter in ein wahres Happening umschlagen ließen. Aber Söllner bleibt auch hier ehrlich und bescheiden. So schildert er offen, wie viel Kraft und Anstrengungen ihn die Streitereien mit der Justiz gekostet haben.
Schließlich biegt die Autobiografie auf der Zielgeraden ein. Söllner ist nun beinahe 60 Jahre alt, er hat selbst Kinder und seine Rolle als bayrischer Rebell oder gar Staatsfeind hat nicht mehr länger Bestand. Musikalisch vollzog er noch den Wechsel vom bayrischen Songwriting zum Reggae. Heute meidet er eher die ganz großen Auftritte und spielt lieber wieder in kleinen Gasthäusern. Er sagt es zwar nicht so, aber der Hype um seine Person ist vorbei, und das weiß er wohl auch. Für den Leser ist nicht recht zu erkennen, ob er jetzt froh oder traurig darüber ist.
„Freiheit muss weh tun“ ist eine offene, spannende und schonungslose Autobiografie über ein Leben, das unglaublich ereignisreich war und das jeden deutschen Kiffer interessieren sollte. Das Buch ist zudem in einem künstlerisch wertvollem Sprach- und Erzählduktus geschrieben, der die spannende Geschichte über Söllners Leben perfekt begleitet. Jeder, der sich für die Geschichte von Songwritern, Kunst über Marihuana, ausgiebiges Kiffen und den Umgang des Staats mit Kiffern interessiert, sollte „Freiheit muss weh tun“ unbedingt lesen. Und die Söllner-Fans sowieso. Eignet sich bestimmt auch gut als Lektüre, nachdem man einen durchgezogen hat. In diesem Sinne: Cheers!
Christian Rausch