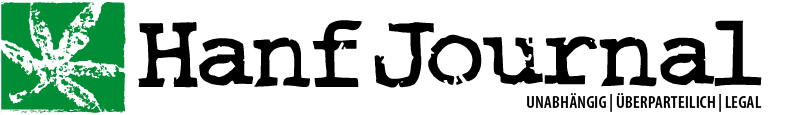Franjo Grotenhermen ist Vorstand und Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin
Wie kann man als Richter eine Aufsehen erregende Entscheidung treffen, ohne dass sie in der Öffentlichkeit Aufsehen erregt? Das haben sich die Richter des Oberverwaltungsgerichts Münster wohl gefragt, als sie im Dezember 2012 über einen Antrag eines Multiple-Sklerose-Kranken aus Mannheim an die Bundesopiumstelle auf Eigenanbau von Cannabis für medizinische Zwecke zu entscheiden hatten.
Der Plan sah offensichtlich so aus
1. Alle wesentlichen Argumente, die die Bundesopiumstelle bzw. die Bundesregierung gegen eine Erlaubnis zum Eigenanbau ins Feld geführt haben, wie zum Beispiel die unzureichende Sicherung der Cannabispflanzen gegen Diebstahl oder der Verstoß gegen internationale Drogenabkommen, waren nicht haltbar und mussten daher vom Gericht zurückgewiesen werden. Über diese Punkte hatte der Patient mit der Bundesopiumstelle bereits mehrere Jahre lang gestritten. Dem Oberlandesgericht war schnell klar, dass die Behörde sich im Unrecht befand. Soweit die Nachricht, die Aufsehen erregt hätte. Das Fazit hätte gelautet: Die Bundesregierung verhält sich mit ihrer grundsätzlichen Ablehnung von Anträgen auf den Eigenanbau von Cannabis für medizinische Zwecke seit Jahren rechtswidrig. Die Bundesopiumstelle kann solche Anträge in Zukunft nicht pauschal ablehnen.
2. Der Antrag des Patienten sollte trotzdem abgelehnt werden. Das Gericht führte zwei recht zweifelhafte Gründe für die Ablehnung des Antrags auf einen Eigenanbau an: (a) der Patient könne auch Dronabinol (THC) aus der Apotheke verwenden, und zum Zeitpunkt der Gerichtsentscheidung sei ärztlicherseits nicht ausreichend nachgewiesen, dass Dronabinol nicht genauso gut wirkt, wie der vom Patienten angebaute Cannabis, und (b) es könnte ja sein, dass die Krankenkasse nun nicht nur (überraschenderweise und auf Drängen des Gerichts) die Kosten für eine Behandlung mit Dronabinol übernimmt, sondern auch für eine Behandlung mit Bedrocan-Cannabis aus der Apotheke aufkommt.
Der Plan ist nicht aufgegangen, denn auch die Ablehnung des konkreten Antrags hat die eigentliche Botschaft nicht verdecken können: die Bundesregierung verweigert Patienten seit Jahren rechtswidrig den Eigenanbau von Cannabis zu medizinischen Zwecken, denn die angeführten Gründe sind rechtlich nicht haltbar.
Der Plan ist auch deswegen nicht aufgegangen, weil die Ablehnungsgründe für Kenner der Materie als fadenscheinig erkannt werden konnten. Erstens hatte der Patient, seine Lebensgefährtin und sein Arzt zuvor schon deutlich gemacht, dass Dronabinol nicht so gut wie Cannabis wirkt, und zweitens hat bisher noch keine einzige gesetzliche Krankenversicherung – der Patient ist bei der AOK versichert – die Kosten für eine Behandlung mit Bedrocan-Cannabis aus der Apotheke erstattet. Besonders auffällig ist allerdings die Tatsache, dass das Gericht nach einem jahrelangen Rechtsstreit mit seinem Urteil nicht noch wenige Wochen warten wollte, bis die Frage geklärt war, ob der Arzt auch schriftlich bescheinigt, dass Dronabinol nicht so gut wirkt wie Cannabis, und auch nicht, ob erstmals von einer gesetzlichen Krankenkasse Cannabis aus der Apotheke übernommen wird.
Das Gericht ging noch einen Schritt weiter und lehnte eine Revision, also eine Überprüfung des Urteils vor dem Bundesverwaltungsgericht ab. Der Fall sollte damit abgeschlossen sein. Jetzt muss der Kläger zunächst gegen die Entscheidung des Gerichts, keine Revision zuzulassen, vorgehen. In die Urteilsbegründung schrieb das Gericht allerdings hinein, dass für den Fall, dass der behandelnde Arzt Dronabinol nicht als gleichwertig wirksam wie Cannabis beurteilt und die Krankenkasse die Kosten für Cannabis aus der Apotheke nicht übernimmt, dem Patienten der Eigenanbau nicht verwehrt werden darf, weil er dann keine Therapiealternativen habe.
Das Urteil hat neben der klaren Botschaft auch für Verwirrung gesorgt, da angesichts der Komplexität des Themas zunächst nicht unbedingt nachvollziehbar war, warum man – wie die Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin (ACM) – ein Urteil begrüßen kann, das dem klagenden Patienten den Eigenanbau von Cannabis für medizinische Zwecke verweigert. Die Deutsche Presseagentur dpa hat sich daher sicherheitshalber den Inhalt der ACM-Presseerklärung vom Gericht bestätigen lassen.
Das Urteil steht in einer Linie mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2000, nach dem Patienten Anträge bei der Bundesopiumstelle auf eine Ausnahmegenehmigung stellen können, die diese in der Folgezeit dennoch alle abgelehnt hat, und dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts von 2005, nach dem die Bundesopiumstelle diese Anträge nicht pauschal ablehnen darf, sondern einzelnen prüfen muss, was dann 2007 widerstrebend zur ersten Ausnahmegenehmigung führte. Ein Blick ins Ausland kann manchmal erhellend wirken. Auch in Israel gab es in den ersten 5-10 Jahren nach dem Beginn des Cannabisprojektes Mitte der neunziger Jahre nur weniger als 100 Genehmigungen für die medizinische Verwendung von Cannabis. Erst in den letzten Jahren ist die Zahl der Erlaubnisinhaber deutlich auf zur Zeit etwa 10.000 angestiegen.
Das aktuelle Urteil des Oberverwaltungsgericht Münster wird vermutlich erst in einigen Jahren richtig gewürdigt werden können. Sein Potenzial ist aber bereits heute erkennbar. Wir werden uns allerdings zunächst weiter mit den Niederungen der politischen Widerstände auseinandersetzen müssen.
Dr. med. Franjo Grotenhermen ist Mitarbeiter des nova Institutes in Hürth bei Köln und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin (ACM).