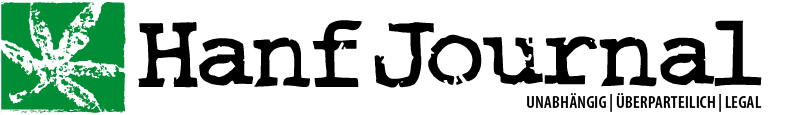Vier Kilometer Schotterstraße außerhalb von Vejer, dort wo hinter den letzten zwei englischen Einfamilienhäusern die Strasse aufhört, liegt Charlies Campo.
Drei Häuser, Dutzende Busse, Lkws, Wohnmobile, Zelte und Autos auf 20.000 Quadratmeter Gelände verteilt, zusammen mit Autowracks, mehreren Feuerstellen, drei Pferden, zwei Ziegen, zwei Enten, einem Schaf, einem Schwein und unzähligen Hunden und Katzen ergeben das, was Charlie bescheiden „das letzte Paradies Europas“ nennt. Leute kommen und gehen, manche bleiben kurz, manche länger, wenige für ganz lang. Wer hier wohnt zahlt 50 Euro pro Monat, wer zu Besuch kommt zahlt nix, weitere Verpflichtungen gibt es keine. Es ist nicht einfach eine Definition für diesen Ort zu finden. Es ist wohl irgendetwas zwischen Kommune und Campingplatz.
Für Besucher, die nur kurz auf Charlies Campo vorbeischauen, muss dieser Platz wirklich wie ein Paradies anmuten. Überall stehen die Türen offen, überall ist man herzlich willkommen, Erwachsene sitzen zusammen und trinken Bier in der Nachmittagssonne, Kinder wetzen über das Gelände, Hunde spielen auf der Wiese. Beinahe jeden Abend gibt es Lagerfeuer, jedes Wochenende Grillerei, die Vollmonde werden ebenso gefeiert wie die Samstage.
Wer länger hier ist, der sieht das etwas differenzierter: Es tut sich nichts, es ändert sich nichts, es ist immer das Gleiche. Hier gibt es keine gemeinsamen Pläne außer den Einkäufen für das nächste Fest, keine längerfristigen Ziele, die über das nächste Wochenende hinausgehen. Die Kinder sind weitgehend sich selber überlassen, stehen unter der Woche oft alleine auf und machen Frühstück, kommen höchstens mal raus, wenn jemand gnädigerweise zum Strand fährt oder in der Schule Exkursion angesagt ist. Die Erwachsenen haben tagsüber einen Bewegungsradius, der kaum über ihre eigenen vier Wände hinausgeht, geschlafen wird ohnehin mit wenigen Ausnahmen mindestens bis Mittag.
Es gäbe so viel zu tun hier. Das Gelände ist groß genug, um einen Garten anzulegen, der alle Menschen mit Obst und Gemüse versorgt. Mit dem Haufen Kinder ließe sich locker eine eigene Schule gründen oder zumindest Schwerpunktgruppen wie Theater, Musik und Tanz. Die Vorbilder, die die Kinder in ihren erwachsenen Mitbewohnern hier haben, sind mehr als dürftig. Außer einem, der als Schmied arbeitet, macht hier niemand etwas aus eigenem Antrieb. Natürlich, es wird Musik gemacht am Lagerfeuer, jedoch ist das doch mehr ein Zeit-tot-Trommeln als wirkliches Interesse am gemeinsamen kreativen Schaffen. Es scheint, als sei für diese Menschen die absolute Freiheit nur mit einer ablehnenden Haltung zu – wie auch immer definierter – Arbeit vorstellbar. Wer von früh bis spät eine Hand mit einer Bierflasche und die andere meistens mit einem Joint belegt hat, kann auch schwer mal anpacken und was zustande bringen. Aber warum? Wie kommt man dazu, so ein Leben führen zu wollen, von dem man nichts mehr erwartet und nichts mehr will? Und wie kommt es, dass diesen Menschen das ständige Feiern, Saufen, Kiffen, Trips schmeißen etc. nicht irgendwann selber zu fad wird?
Vier Jahre waren wir mittlerweile unterwegs, zuerst mit einem Mercedes-Bus, später, als Familienzuwachs kam, mit einem umgebauten Lkw derselben Marke. In dieser Zeit haben wir viele Menschen kennen gelernt, die ebenfalls nomadisch lebten, und dabei wurde uns eines klar: Leute wie uns gab es entweder nicht oder sie waren irgendwo anders unterwegs. Die Menschen, die wir trafen, hatten sich normalerweise nicht vollkommen freiwillig für diese Lebensform entschieden, viele waren auch nicht wirklich glücklich damit und sahen es als eine Übergangslösung, bis sich was besseres auftun sollte. Ein Großteil war geflüchtet – vor den Eltern, vor den Lebensumständen, vor Freiheitsstrafen, vor Schulden, vor der Arbeit. Wir waren mit unserem Unterfangen, auf unserem Weg den Sinn des Lebens zu finden, ziemlich allein; der eine Teil hatte ihn schon abgeschrieben, der andere glaubte, ihn schon gefunden zu haben: in Nichtstun, totalem Anarchismus und noch mehr Flucht – Drogen und Partys, Partys und Drogen.
Charlie, der Grundbesitzer. Ein Seniorhippie wie aus dem Handbuch, wenn es denn eines gäbe. Knapp 50 – sowohl Alter als auch Gewicht – mit schulterlangen grauen Haaren, die nie gekämmt werden und einem Triumvirat von Körper, Geist und Seele, welches die Jahrzehnte des massiven Drogenkonsums nicht verleugnen kann. Krummer Rücken, schlurfender Gang, Mühe beim Sprechen, eine Leber, die nicht mehr wirklich funktioniert. Aus wohlhabendem Elternhaus stammend, schnallte er schon während der Schulzeit, dass mit dem Verkauf von Hasch und Kokain viel leichter Geld zu machen ist als mit einer ehrlichen Arbeit, Partys satt viel mehr Spaß machen als Büffeln und brav ins Bett gehen. Die weltfremde Mutter bekam von alledem nichts mit, der Vater war nie da. Als die Polizei in der Schule die Coca Cola-Automaten auseinander nahm und die Schultaschen filzte, musste sie mit leeren Händen wieder abziehen, weil Charlie und seine Jungs schon damals zu clever waren um sich erwischen zu lassen. Der Crash gegen einen Baum auf der Flucht vor den Bullen in Spanien kostete ihn zwar beinahe alle Zähne, aber auch damals kam er von Rechts wegen davon.
Charlie ist die Blaupause von Menschen wie Mr. Nice und anderen, die es geschafft haben, aus ihrer Lebensgeschichte Kapital zu schlagen und drogenmäßig die Kurve zu kriegen. Auch er hat unglaubliche Geschichten zu erzählen, aus seiner Zeit als Lkw-Fahrer im Libanon und im Irak, den Jahren, die er in Goa lebte, den Anfängen, als er vor über 20 Jahren hierher nach Andalusien kam, zusammen mit all den anderen Hippies, die nunmehr brave Familienväter sind, ihr Grundstück gekauft und Haus gebaut haben und Charlie nicht mehr kennen wollen. Sie leben in der so typischen Bigotterie, froh zu sein, etwas zu rauchen zu haben, aber nur ja keinen zu engen Kontakt mit Menschen haben zu wollen, die mit dem Zeug wirklich handeln oder wie in Charlies Fall, damit gehandelt haben und dazu stehen.
Im Gegensatz zu ihnen hat Charlie sein Leben von damals nicht geändert, auch mit Familie, glaubt immer noch felsenfest an das Miteinander und das Teilen statt Besitzenwollen und an die maximale Toleranz unterschiedlichen Lebensformen gegenüber – eine Lebenseinstellung, die ihm von seinen Nachbarn nicht immer leicht gemacht wird, von seinen Mitbewohnern ebenso wenig.
Charlie ist es schließlich auch, der mir die Erklärung für die Lebensweise der Menschen hier liefert. „Weißt du“, sagt er einmal abends am Lagerfeuer zu mir, „wenn du die Leute hier kennen lernst, findest du ganz schnell heraus, dass sie gar nicht so durchgeknallt sind wie sie tun. Die meisten haben wirklich was in der Birne, das willst du so, wenn du sie siehst, gar nicht glauben.“ – „Warum tun sie dann so durchgeknallt?“ frage ich ihn, mehr spaßeshalber als wirklich auf eine befriedigende Antwort hoffend. Ich sollte überrascht werden: „Weil wir nichts anderes gelernt haben“, meint er ganz ernst, „wir haben nichts anderes gelernt als richtig Partys zu feiern. Das ist das Einzige, was wir können, und das machen wir eben.“