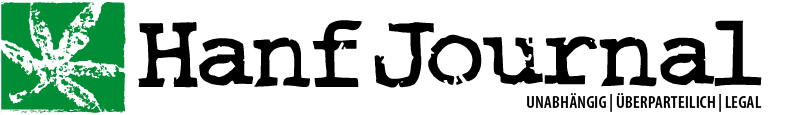Die neue Drogen-Strategie der Europäischen Union (EU)
Die Mehrheit der NiederländerInnen und der französischen Bevölkerung sagen NEIN zu dem europäischen Staatsvertrag – auch EU-Verfassung – genannt. Die Absage ist nicht irgendeine Ablehnung, sondern kommt aus zwei europäischen Kernländern und Gründungsmitgliedern der EU. Es ist eine Absage an die etablierten Parteien und zeigt einmal mehr, dass die PolitikerInnen nicht die Meinung ihrer potenziellen WählerInnen vertreten. Der Unmut der Bevölkerung richtet sich unter anderem gegen ein „Europa der Konzerne und Generäle“. Die Finanzierung der Um- und Aufrüstung der EU-Armeen geht auf Kosten der Sozialsysteme. Soziale Belange werden hinten angestellt. Neoliberalismus ist angesagt. Und an dieser Stelle ist es an der Zeit, mal die Drogen-Politik der EU genauer unter die Lupe zu nehmen.
Im Rahmen von Verordnungen, Richtlinien, Entscheidungen, Empfehlungen und Stellungnahmen nimmt die Europäische Union Einfluss auf die Gesetzgebung ihrer Mitglieder. In diesem Zusammenhang denke man an die Feinstaub-Richtlinie oder das Anti-Diskriminierungs-Gesetz, welche Eingriffe der Gemeinschaft auf die Gesetzgebung der Mitgliedsstaaten waren und durch alle Medien gegangen sind. Die europäischen Drogen-Politik, oder besser gesagt die Drogen-Bekämpfungs-Politik, kann zwar nicht auf ein besonderes öffentliches Interesse verweisen, trotzdem hat sie bereits 15 Jahre Geschichte hinter sich. Eine gemeinsame europäische Politik machte im Jahre 1990 das Schengener Abkommen notwendig. Mit dem Wegfall der Binnengrenzen begann die staatenübergreifende Kooperation gerade auch innerhalb der Drogen-Bekämpfungs-Politik.
Angefangen hat die europäische Anti-Drogen-Zusammenarbeit schon Mitte der 80er-Jahre mit gemeinsamen Maßnahmen zur Bekämpfung der Drogen-Abhängigkeit. Danach folgte ein erster Europäischer Drogen-Bekämpfungs-Plan, der vom Europäischen Rat von Rom 1990 verabschiedet, 1992 überprüft und aktualisiert wurde. Ein Jahr später wurde die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogen-Sucht eingerichtet. Darauf folgten in den Jahren 1996 bis 2000 und 2000 bis 2004 zwei Aktionspläne zur Drogen-Bekämpfung. Resümierend muss festgestellt werden, dass die ergriffenen Maßnahmen weitestgehend ohne Erfolg geblieben sind und sich an das Prinzip der Prohibition zur Verringerung des Drogen-Konsums und zur Sucht-Prävention festgeklammert wurde.
Einschneidende Neuerungen oder deutliche Veränderungen zur nationalen Drogenpolitik hat es nicht gegeben. Die Drogen-Politik wurde nur auf die Füße einer grenzüberschreitenden Kooperation in der Strafverfolgung, der Schaffung gemeinsamer Maßnahmen und dem Informations-Austausch gestellt. Im letzten Jahr haben die Beratungen im Europäischen Parlament und Europäischen Rat über eine neue Strategie zur Drogen-Bekämpfung für den Zeitraum 2005 bis 2012 begonnen, mit jeweils zwei Aktionsplänen für die Jahre 2005 bis 2007 und 2009 bis 2011, wobei auf jeden Aktionsplan eine einjährige Evaluierungsphase folgt.
Drogen-Politik und das Europa-Parlament
Eine wirklich grundlegende neue Entwicklung zeichnet sich seit 2004 nur im Europäischen Parlament ab. Der Abgeordnete Giusto Catania, Mitglied des Ausschusses für bürgerliche Freiheit, Justiz und Inneres, hat im Auftrag des Parlaments einen Vorschlag für eine Empfehlung des Europäischen Parlaments an den Europäischen Rat erstellt, welcher im Dezember 2004 von den Parlamentariern verabschiedet wurde. Dieser so genannte „Catania Report“ stellt einen Bruch mit den Ansichten und Maßnahmen der bisherigen Strategien und Aktionspläne dar. In ihm wird die Wirksamkeit der Prohibition in Frage gestellt und eine wissenschaftliche Prüfung sowie eine vollständige Evaluierung der vergangenen Maßnahmen gefordert. Wie sinnvoll ist eigentlich noch eine Prohibition insbesondere von Hanf, und stellt die Fülle an Strafdelikten nicht eine unnötige horrende Belastung für das Strafsystem dar?
Es wird klar und deutlich die Schlussfolgerung gezogen, dass die beiden ersten Aktionspläne mit ihren Zielen gescheitert sind und ein Misserfolg nicht geleugnet werden kann. Und die Drogen- und Sucht-Bekämpfung wird nicht als „Krieg gegen Drogen“ verstanden, sondern als soziale Intervention. Das Europäische Parlament beschreitet mit diesem Dokument auf europäischer Ebene neue Wege hin zu einer rational am Menschen orientierten Drogen-Politik. Letztendlich ist vor allem die Cannabis-Prohibition auf eine ideologisch geführte internationale Verbots-Kampagne zurückzuführen. Bei einer rationalen wissenschaftlichen Betrachtung der potenziellen Gefahren von Cannabis wäre es fraglich, ob sich nach diesen Kriterien ein Verbot weiter begründen lassen würde. Abzuwarten bleibt trotzdem, wie sehr wissenschaftliche Resultate letztendlich zum Tragen kommen.
In einem Hearing am 21. April 2005 im Plenum des Europäischen Parlaments wurde ein Wechsel in der Drogen-Politik auf Grundlage des Catania-Reports bestätigt. Dort berichtete unter anderem ein Mann aus Rom über die Geschichte des 23-jährigen Süditalieners Giuseppe, der wenige Monate zuvor wegen des Anbaus von drei Hanf-Pflanzen verhaftet worden war. Anschließend wurde er in seinem Dorf wie ein Aussätziger behandelt und von den Bewohnern in jeglicher Weise ausgegrenzt. Letztendlich nahm er sich deswegen das Leben. Eine dramatische Geschichte, die selbst die Parlamentarier nicht unberührt ließ. Sie unterstreicht auf tragische Weise nochmals, wie fundamental ein grundlegendes Umdenken in der Drogen-Politik ist.
Leider ist das Europäische Parlament kein Parlament im ursprünglichen Sinne und ist nicht in der Lage, alleine verbindliche Rechtsvorschriften zu erlassen. Diese Befugnis hat nur der Rat der Europäischen Union, welcher mit den Fachministern der jeweiligen Ressorts besetzt wird. Während also das Europäische Parlament eine liberale und zeitgemäße Drogenstrategie empfiehlt, vertritt der Rat in einem Vermerk des Generalsekretariats bis auf einige marginale Neuerungen die veralteten Ansichten, gestützt durch die Prohibition und eine daran gekoppelte strafrechtliche Verfolgung.
Die Drogen-Strategie vom Rat der Europäischen Union
Der Rat hat sich im vergangenen Jahr auf eine neue Drogen-Strategie geeinigt. Darin wird sich vornehmlich auf herkömmliche Themenfelder beschränkt und keine neuen Ansichten oder Maßnahmen etabliert. Was darauf zurückzuführen ist, dass sich die Richtlinie auf die EU-Drogen-Strategie und den EU-Drogen-Aktionsplan (2000 bis 2004) stützt. Die Schwerpunkte liegen auf der Koordinierung, der Reduzierung von Angebot und Nachfrage sowie der internationalen Zusammenarbeit, insbesondere der Justiz. In der Strategie lassen sich zwar Überschneidungen mit dem Catania-Report finden, wie in der Forderung nach einem ausgewogenen integrierten Konzept, einer breit gefächerten Zusammenarbeit mit Nicht-Regierungs-Organisationen, der Einbezug der Ergebnisse aus Forschung und Wissenschaft und die Anwendung von präventiven Maßnahmen. In der konkreten Ausformulierung und der Zielsetzung wird aber schnell deutlich, dass der Kontext und die Ausrichtung eine ganz andere ist.
Die Zusammenarbeit hat ihren Schwerpunkt bei einer polizeilichen Kooperation zur strafrechtlichen Verfolgung und zum Schutz der EU-Außengrenzen gegenüber Drittstaaten, aus denen Drogen eingeführt werden. Die Bekämpfung des Drogen-Konsums, des Drogen-Handels und der Drogen-Herstellung genießt absolute Priorität. Es wirkt wie ein naives Festhalten an dem Gedanken einer drogen- und suchtfreien Gesellschaft, in der Drogen durch einen reibungslos funktionierenden Polizeiapparat gänzlich aus dem Alltag vertrieben werden, was schlichtweg Utopie ist. Der Entwurf plädiert für die Forderung nach einer einheitlichen Strafverfolgung für ganz Europa. Hierbei stellt sich die Frage, auf welcher Grundlage man sich eine Anpassung der Strafverfolgung vorstellt. Soll ein Mittelmaß gefunden werden oder eine restriktive oder extensive Anpassung erfolgen? Mit Sicherheit kann davon ausgegangen werden, dass die Verantwortlichen keine Anpassung im Sinne haben, die sich an einem liberalen Modell orientiert. Unter dem Aspekt von Ergebnissen aus Forschung und Wissenschaft wird hauptsächlich auf die Wissensbasis und den Informationsaustausch zur Drogen-Therapie oder Drogen-Bekämpfung verwiesen, eine Revision von herkömmlichen politischen Problemlösungsmethoden wird dabei nicht in Betracht gezogen.
Der rote Faden, der sich durch den Entwurf zieht, ist die Drogen-Bekämpfung im Rahmen der internationalen Organisationen und Verträge (VN-Übereinkommen). Damit wird deutlich, welche Motivation hinter diesem Entwurf steht: alte und neue Maßnahmen möglichst in Einklang mit dem Übereinkommen der Vereinten Nationen zu bringen. Um die Umsetzung einer anderen Drogen-Politik als bisher möglich zu machen, müsste man sich über die internationalen Verträge und Übereinkommen hinwegsetzen. Obwohl die schlechten und unzureichenden Ergebnisse der bisherigen Drogen-Strategien und -Aktionspläne eine deutliche Sprache nach der Notwendigkeit von Reformen sprechen, wird nichts grundlegend Neues angesprochen. Der Rat hat sich mit diesem Entwurf definitiv nicht aus seinem Schützengraben der Prohibition hervorgetraut und nur ansatzweise die Möglichkeit einer anderen Politik offen gelassen. Stattdessen soll alles so bleiben wie bisher: Den Kern der klassischen Drogen-Bekämpfungsstrategie bilden wie gehabt Prohibition und Strafverfolgung mit dem Ziel, Angebot und Nachfrage zu reduzieren.
Ausblick und Bewertung
Solange die Europäische Verfassung nicht verabschiedet ist, wird sich in der Drogen-Politik nichts ändern. Denn mit diesem Staatsvertrag wäre das Parlament gestärkt und Mitgesetzgeber in nahezu allen Fällen geworden. In der Realität sieht der Sachverhalt leider anders aus und die Entscheidung in diesem Politik-Bereich liegt beim Rat, dessen Einstellung weiterhin auf konservativen Ansichten beruht, und es ist kaum zu erwarten, dass der Rat jene entscheidenden Elemente des Catania-Reports berücksichtigen wird, die zu einer fundamentalen Neuausrichtung in der Drogen-Politik hätten führen können. Die hauptsächliche Beschlussfassung liegt in vielen Bereichen beim Rat. Damit den Entscheidungen der EU eine demokratische Rechtmäßigkeit zugrunde liegt, sind in ihm die Fachminister der Mitgliedsstaaten vertreten, die durch die Regierungs-Wahlen in den Nationalstaaten legitimiert sind.
Eine demokratische Legitimation bleibt aber fraglich, wenn durch die Entscheidungen eines staatlichen oder, wie in diesem Fall, überstaatlichen Gremiums die Belange einer großen Bevölkerungsgruppe unter den Tisch fallen und sie zudem noch kriminalisiert wird, aufgrund von schwammigen und antiquierten Argumenten. Selbst in dem unwahrscheinlichen Fall, dass die klassischen Methoden und Argumente einer wissenschaftlichen Prüfung standhielten, was nach dem derzeitigen Erkenntnisstand zu bezweifeln ist, sollten die Verantwortlichen die Bereitschaft zeigen, ihren Standpunkt von unabhängigen Experten prüfen zu lassen. Wenn deren Ergebnis eine Drogen-Politik befürwortet, die einer liberaleren Linie folgt, dürfen sich die Politiker nicht wegen der Verpflichtung gegenüber internationalen und vor über 40 Jahren geschlossenen Verträgen scheuen, die Drogen-Politik zu reformieren.
Die Drogen-Politik, wie sie derzeit in der EU und in den meisten Nationalstaaten betrieben wird, orientiert sich nicht an den Bedürfnissen des Bürgers. Dabei sollte die Zielsetzung der Politik immer das Wohl des Bürgers zum Maßstab haben, vor allem dann, wenn vorherige Maßnahmen bereits Misserfolge verbuchen konnten und die Ziele nicht erreicht wurden. Spätestens dann sollten die Verantwortlichen die repressive und gescheiterte Strategie aufgeben und eine extensivere und liberalere Strategie an deren Stelle setzen. Doch selbst wenn die Verantwortlichen ihre konservativen Ansichten über Bord würfen, heißt es in Artikel 152 des EG-Vertrages ausdrücklich: „Die Gemeinschaft ergänzt die Maßnahmen der Mitgliedsstaaten zur Verringerung drogenkonsumbedingter Gesundheitsschäden einschließlich der Informations- und Vorbeugungsmaßnahmen.“ Dennoch wären die Ausstrahlungseffekte von Brüssel auf die nationalen Regierungen wohl nicht zu unterschätzen.
Jüngst hat sich auch der niederländische Reformminister Alexander Pechthold für eine europaweite Legalisierung von Haschisch ausgesprochen und deswegen scharfe Kritik der konservativen Regierungspartei bekommen. Pechthold wies die Kritik zurück und argumentierte: „Wir müssen uns trauen, über dieses Thema zu reden.“ Er sieht in der Legalisierung langfristig das beste Mittel, um zumindest dem Problem des Drogen-Tourismus zu begegnen. Diesem Vorschlag kann nur beigepflichtet werden, aber die Problemlösungsfähigkeiten einer Legalisierung von Cannabis wären wohl noch weitaus umfassender als die Beseitigung des Drogen-Tourismus.