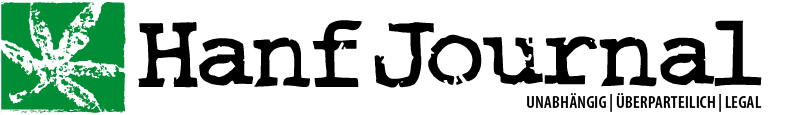Auf der Jagd nach Nepals wildem Hanf
In Pokharas Touristenviertel:
„Can I help you with anything?“ kommt mir ein wenig vertrauenserweckender Typ entgegen.
„No.“ Obwohl, gerade solche sollten doch eigentlich ´ne Ahnung haben . . .
„Ok, stop, I ever wanted to see wild Ganja.“
Und so kam es dann, dass ich morgens früh um fünf mit gepacktem Rucksack über den Zaun von meinem Hotel springe und mich mit meinem neu gewonnenen Freund auf den Weg zu den Plantagen mache. Anstatt wie andere Führer unterwegs auf die Schönheiten der Natur aufmerksam zu machen, zeigt mein Kollege mir stolz seine in zahlreichen Straßenschlachten erworbenen Narben und erzählt, dass er bisher 63 mal im Gefängnis saß. Aber immer nur wegen Dope oder Schlägereien. Wie beruhigend.
Wir marschieren strammen Schrittes den Zulauf des Fewasees entlang und schon recht bald breitet sich eine atemberaubende Kulisse neben uns aus. Die Sonne bricht durch die Wolken und beleuchtet die höchsten Berge der Welt, die hier zum Greifen nah scheinen. Stunden später, als die Straße schon längst in einen Schotterweg übergegangen und der Schotterweg schließlich von den zahlreichen Flussarmen zu einer Reihe Steine dezimiert wird, über die man hüpfen kann, erreichen wir ein Dorf in einem Talkessel.
Mein Führer erzählt über das Dorf. Eine Hochburg der Maoisten, einer semiprofessionellen Guerillaarmee, die noch bis vor kurzem mit der Regierung Nepals Krieg geführt hat. Wer auch immer in Pokhara entführt wird, wird hier versteckt gehalten. Nepal hat politisch harte Zeiten hinter sich. Erst hat sich eine Reihe Könige hintereinander ins Amt gemetzelt, dann wurden die maoistischen Rebellen übermütig. Kriegszustand, Ausgangssperre etcetera. Kein Wunder das die Nepalis den Namen ihres Landes gern als Abkürzung bezeichnen für: NEver Peace And Love.
So machen wir uns dann steil aufwärts. Es dauert nur Minuten, bis ich vor Anstrengung kotzen könnte, während mein Führer mir wie eine Gemse voraushoppelt, ohne jegliche Ermüdungserscheinungen.
Nepal, das Dach der Welt. Wir stehen Aug in Aug mit den höchsten Punkten der Erde. Das da oben ist beinah Reiseflughöhe eines Linienjets. Zerzauste Schneefahnen ziehen sich von den Gipfeln, verraten, wie grausam es dort oben ist, trotz des glasklaren, erhabenen Anblicks. Um uns herum jedoch: Dschungel. Eine leichte Brise lässt die Bananenhaine rascheln, die selbst hier oben noch gedeihen. Es tschilpt, zwitschert und schreit in den dunklen Tiefen rechts und links unseres Weges. Immer wieder müssen wir Bachläufe hüpfend oder balancierend überqueren. Immer tiefer in den Dschungel, immer höher den Berg hinauf.
Stundenlang, bis wir auf einem Bergkamm stehen. Mein Führer blickt auf der anderen Seite herab und sein Blick erstarrt. Vor uns liegt ein Feld daumendicker Baumstümpfe. Das war wohl mal Ganja. Verzweifelt sucht er die nächste Hütte und fragt, was passiert ist. „Maoist Cut“ ist die Antwort. Und auf Nepali wird erklärt, dass die Maoisten, seit sie an der Regierung beteiligt sind, sich gerne als wahre Hüter der Gemeinschaft aufspielen. Seit ihrer Partizipation an Nepal‘s Regierung sind sie wie entfesselt, versuchen nun überall, ihren Einfluss geltend zu machen und dem Volk ihre Vorstellung von gutem Leben aufzudrücken. Sie sehen sich als Retter des Volkes. Unter anderem mit einem sehr fragwürdigen Krieg gegen die Droge, die hier seit Jahrtausenden mit den kulturellen Traditionen verwoben ist. Aber ob das Volk überhaupt gerettet werden will? Selbst alte Männer rauchen hier Ganja, um ihre zahlreichen Wehwehchen zu bekämpfen und auch die Kühe kriegen aus dem Weed spezielle Fladen gebacken, wenn sie mal wieder Durchfall haben. Das schert die Maoisten herzlich wenig. Wo immer ihnen Pflanzen begegnen, machen sie sie nieder und fahren sie, teilweise in ganzen LKW-Ladungen, zur nächsten Polizeistation, um die Polizisten auf ihre Versäumnisse hinzuweisen. Die Polizei selbst ist daran eher weniger interessiert. Ganja ist in Nepal ja eigentlich auch eher wegen der Ausländer illegal, weil die es eben nicht in der vertretbaren Menge konsumieren, wie es die Bergbevölkerung tut. Das haben die Hippies in Kathmandus Freak Street zur Genüge bewiesen. Erst seit deren Exzessen ist es (damals noch per königlichem Dekret) verboten worden. Außer in den Tourigegenden wurde das aber nie wirklich durchgesetzt. Die Leute in den Dörfern behandeln Ganja nach wie vor wie sie auch Blumenkohl und Reis behandeln. Sie pflanzen es ohne jede Scheu direkt vor ihr Haus. Zumindest bis vor kurzer Zeit.
Das ist jetzt nicht mehr so. Wir ziehen immer weiter über die sieben Berge in Richtung der sieben Zwerge und jeder, der uns begegnet, erzählt, dass die Pflanzen seiner Gegend entweder von den Maoisten selbst gekillt wurden, oder eben zum frühestmöglichen Zeitpunkt geerntet, um deren Zugriff zu entgehen. Aus Angst kommt die Klinge so früh wie möglich zum Einsatz. Die Maoisten sind hier oben bei den Growern und Rauchern nicht sehr beliebt. Dennoch treten immer mehr junge Leute zu ihnen über, um sich mit deren Seilschaften auf einen einflussreichen Posten zu hieven. Schwere Zeiten für unsere Lieblingspflanze.
Und so ziehen wir weiter von Haus zu Haus. Überall bekommen wir angeboten, uns Ganja zu zeigen, aber es handelt sich immer nur um Heuböden voller trocknender Büsche. Keine Pflanze weit und breit. Bis wir auf Manu treffen. Einen jungen Mann, der uns mit einem schelmischen Grinsen hinter sich herschleift. Eine Pflanze steht noch, sagt er. Ein letztes gallisches Dorf.
Wir riechen sie lange bevor wir sie sehen. Ein Aroma wie Mango mit einem Hauch Orange. Wir kommen um die letzte Wegbiegung und stehen einem prachtvollen Busch gegenüber. Weit ausladend erhebt er sich vor dem Panorama der höchsten Berge der Welt, die heute zum ersten Mal glasklar sichtbar sind. Zum Glück ist Manu der einzige, der von dieser Pflanze weiß und er selbst raucht (eigentlich) nicht, sonst wäre der Busch wohl auch schon längst dem Khukurimesser zum Opfer gefallen. Ein Riesenteil, größer als ich, mit einer prächtigen Krone. Ich ziehe einen der Äste zu mir und krieg mich gar nicht mehr ein. Alles voller Kristalle, so wie man es sogar selten auf Hollandgras sieht. Selbst die äußersten Blätter sind noch mit einer Schicht Puderzucker überzogen. Und es stinkt wie Sau. Wie Gras eben riecht, aber mit einem ganz klaren Mangoaroma. Ich krieg‘ meine Nase gar nicht mehr aus dem Busch und die anderen beiden lachen mich schon aus.
An den untersten Ästchen ist das Gras schon komplett durchgetrocknet. Wir reißen ein Büschel ab, machen es klein und wickeln ein Paper drum. Das ist ja wie beim Drive-In Schalter vom Mc Donalds hier! Es raucht sich selbst pur total smooth, aber schon bei den ersten Zügen drückt es uns die Augen zu. „Hui“ sagen wir alle drei immer abwechselnd. Es ist das einzige, was uns dazu einfällt. Hui. Da wir ja anscheinend niemandem etwas wegnehmen, machen wir uns daran die allerleckersten Äste auszusortieren. Ein lustiges Spiel. Alle drei rennen um die Pflanze und schnüffeln und gucken und vergleichen und zeigen sich gegenseitig Lieblingsästchen und Unterästchen, vergleichen Hauptbuds mit Nebenbuds, fachsimpeln darüber, welcher Blütezustand (unten ist er schon ganz verblüht, oben noch knallegrün) wohl der optimale zum Ernten ist und wo wir die Schnitte ansetzen sollten. Letztlich haben wir einen ganz ansehnlichen Stapel zusammen und die Pflanze sieht immer noch aus, als wären wir nie dagewesen.
Da Manus Mutter auch selbst anbaut, kann er mir ein bisschen was dazu erklären. Er sagt, es gibt hauptsächlich zwei Sorten Gras hier oben, vor deren besserer wir gerade stehen. Und aus jeder der beiden kann man zwei verschiedene Sorten Hasch machen. Charras, das schwarze klebrige, indem man die Pflanze (noch lebendig und im Boden) zwischen den Händen reibt. Das kann man mehr mehrmals pro Saison wiederholen. Zum Charras-Machen gibt es angeblich sogar eine Maschine, aber wie genau die funktioniert konnte er mir auch nicht erklären. Und dann gibt’s noch Pollum, das sie hier herstellen, indem sie die Pflanzen einfach über Stoffbahnen ausklopfen und die herabgefallenen Pollen pressen.
Und los geht’s, wir machen uns wieder auf den Weg. Manu läuft mit der Tüte 20 Meter vor mir und ich komme mir die ganze Zeit vor, als würde ich immer noch mitten in dem Busch stehen, so intensiv riecht es selbst durch zwei Lagen Plastik. Mango, hmmmmm! Und so komme ich mir vor wie der Esel, dem man eine Rübe vor die Nase hält, damit er schneller läuft. Denn meine Begleiter legen schon wieder ein aberwitziges Tempo vor. Ein ganzes Volk von Gemsen ist das hier.
Und plötzlich beginnt einer meiner Begleiter, einen Bob Marley-Song anzustimmen und der andere stimmt sofort ein. Und wie das unter Kiffern so üblich ist, kann natürlich auch ich den Text. Und so gröhlen wir zu dritt „get up, stand up – stand up for your right!“, was ja angesichts der derzeitigen Lage unserer Lieblingspflanze sogar ein ganz passender Ansatz ist. Aber weniger anstrengend wird der Weg dadurch auch nicht.
Aber, hey stop, wir sind doch jetzt getuned, warum nicht einfach heimfliegen? Was als Scherz über unseren ziemlich abgehobenen Zustand nach der Purtüte klingt, ist in Wahrheit eine geniale Idee. Nicht weit von hier ist gerade Nepals offene Paraglidingmeisterschaft und für ein paar Dollar sitzen ich und die Tüte voll Weed tatsächlich im Tandemgleiter. „RUN“ schreit mein Hintermann, reißt den Schirm hoch und ich renne auf einen Abgrund zu, bin mir schon todsicher, dass ich sterben werde, mache meinen letzten Schritt in die Luft und . . .
. . . der Schirm trägt mich. Wow. Das ist wie Fliegen. Ach so, es ist ja wirklich Fliegen. Ich bin wirklich etwas verwirrt. Killergras, wow. Ich winke meinen beiden Freunden, die auf dem Berg zurückbleiben, mit der Tüte in der Hand zu und lasse mich von den thermischen Strömungen immer höher und höher nach oben kreiseln. Adler ziehen neben, über und unter uns ihre Bahnen. Die Welt unter meinen Füßen ist nur noch Miniatur. Und ich sitze einfach in der Luft rum. Irres Gefühl. Aber irgendwie fast ein bisschen langweilig. Ich frage meinen Piloten, ob er denn auch ein paar Tricks kann und wecke damit anscheinend seinen Ehrgeiz, denn die nächsten Minuten gleichen eher einer Achterbahnfahrt. Wir rotieren um uns selbst, taumeln durch die Luft, kippen jäh zur Seite, liegen plötzlich waagerecht über dem See, der scheinbar endlos unter uns vor sich hinglitzert. Dann Füße ausfahren – Landung, rennen, rennen, rennen und der Schirm kippt hinter uns auf den Boden. WOW, was ein Ritt.
Ich bleibe noch ein bisschen stehen und gucke zu, wie ein Profiparaglider nach dem anderen sich bei seinen spektakulären Stunts verheddert und wie ein Stein in den See plumpst. Froh, immer noch trocken zu sein, mache ich mich auf den Heimweg und fange an, meine neu gewonnene Beute zu trocknen. Als die Chefin meines Hotels mich später fragt, ob ich in meinem Zimmer Parfum versprühe, kann ich mir ein Grinsen nicht verkneifen.