Thomas de Quincey: Bekenntnisse eines englischen Opiumessers
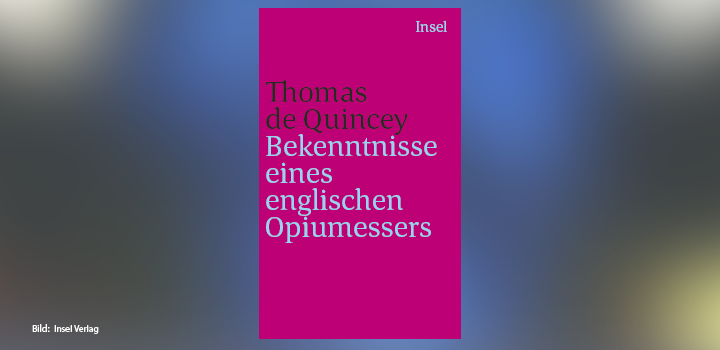
„De Quincey verbindet die kritische Analyse mit zeitbewusster Verallgemeinerung. … Das Schwergewicht liegt dabei letztlich weniger auf der Beschreibung, sondern auf der Reflexion, … , daß die äußeren Eindrücke über die inneren Bedingungen wirken“, bemerkt zu Recht der Verlag im Vorspann.
Den ersten Teil kann man sich allerdings sparen, die ausführlich beschriebene Jugendzeit des späteren Opiumessers ist eher was für Liebhaber exotischer Unwichtigkeiten. Auch der Schreibstil ist gewöhnungsbedürftig, aber durchaus etwas für Leser, die Eskapaden selbstverliebter Formulierungskünstler schätzen. Detailversessen verliert er sich in nicht enden wollenden Beschreibungen von zu seiner Zeit sicherlich aktuell brennenden religiösen und philosophischen Diskussionen, aber es blitzen immer wieder hell- und weitsichtige Gedanken auf, die ihn als einen seiner Zeit weit vorauseilenden Geist ausweisen. So unterscheidet er zwischen Patriotismus, den er wohlwollend bewertet, und Nationalismus. „Letzterer aber, das habe ich immer wieder festgestellt, ist niedrig, ist unehrlich, ist kleinlich, ist der Aufrichtigkeit unfähig; ständig von der Versuchung zur Falschheit bedrängt, endet er nur zu oft in gewohnheitsmäßiger Lüge.“ Wenn man bedenkt, dass das bis heute leider nur die wenigsten kapiert haben, kann man vor diesem Mann nur den Hut ziehen und davon ausgehen, dass auch alles andere, was er schreibt, Hand und Fuß hat.
Und wenn man sich dann endlich bis Seite 182 durchgearbeitet hat, wird man dafür umso mehr belohnt. Nach einer ausführlichen Beschreibung seiner Kopfschmerzen – und einer noch ausführlicheren des Apothekers, der ihm das erste Fläschchen Opium gegen diese Schmerzen verkaufte und den er als extra für ihn vom Himmel gesandten Boten verklärt – kommt er zur Sache und beschreibt, was er bei seiner ersten Ladung erlebte:
„Ich nahm es; und nach einer Stunde, o Himmel, welch ein Umschwung! Welch Wiedererwachen verborgener Geisteskraft aus tiefsten Tiefen! Welche Apokalypse der Welt in mir! Dass meine Schmerzen verschwunden waren, wurde in meinen Augen zu einer Kleinigkeit; der negative Effekt wurde von der ungeheuren Größe jener positiven Auswirkungen verschlungen, die sich vor mir in der Unendlichkeit des göttlichen Vergnügens auftaten, das sich mir plötzlich offenbart hatte. Hier gab es ein Allheilmittel, ein »Pharmakon nepenthes« für alles menschliche Weh; hier war das Geheimnis des Glücks auf einmal entdeckt, über das die Philosophen so viele Jahrhunderte diskutiert hatten; das Glück konnte jetzt für einen Penny gekauft und in der Westentasche mitgenommen werden, tragbare Ekstasen konnte man auf Halbliterflaschen abgezogen bekommen, und Seelenfrieden ließ sich mit der Post versenden.“
Daraufhin erklärt er, dass alles Quatsch sei, was bisher über Opium geschrieben wurde und jetzt er kommt, der klarstellt, was wirklich Sache ist, auch im Vergleich zu anderen Rauschmitteln, zum Beispiel Wein:
„Während Wein die geistigen Fähigkeiten in Unordnung bringt, stellt Opium (wenn es in richtiger Weise genommen wird) dagegen die hervorragendste Ordnung, Gesetzgebung und Harmonie unter ihnen her. Wein beraubt den Menschen seiner Selbstbeherrschung; Opium erhält und verstärkt sie. Wein vermindert die Urteilsfähigkeit und verleiht der Verachtung und der Bewunderung, der Liebe und dem Hass des Trinkers einen übernatürlichen Glanz und eine lebhafte Begeisterung; Opium vermittelt dagegen allen Fähigkeiten, seien sie aktiv oder passiv, Gelassenheit und Gleichgewicht.“
So geht das zweieinhalb geschlagene Seiten nur zu diesem einen Vergleich, also es bleibt kein Auge trocken und nicht das kleinste Krümelchen restlicher Unklarheit. Folgerichtigerweise meißelt er am Ende dieser kleinen Abhandlung keinen Widerspruch duldend und keinen Zweifel lassend für alle Zeiten in Beton:
„Dies ist die Lehre der wahren Kirche über das Thema Opium; ich betrachte mich selbst als Papst dieser Kirche (infolgedessen bin ich unfehlbar) und als selbsternannten légate de latere für alle Breiten- und Längengrade. Es sei aber daran erinnert, dass ich von der Plattform weiter und gründlicher Erfahrungen aus spreche, während die meisten der unwissenschaftlichen Autoren, die überhaupt Opium behandelt haben, …, es durch den von ihnen zum Ausdruck gebrachten Schrecken deutlich werden lassen, dass ihre praktische Erfahrung auf dem Gebiet seiner Wirkungsweise absolut gleich null ist.“
Letzteres ist in Bezug auf die Ergüsse inkompetenter Cannabis-Verteufeler an Aktualität nicht zu überbieten.
Wir aber können nun getrost der Enzyklika des Opium Papstes folgen und ihre Dogmen auch auf andere, uns bekannte und genehme „Erhebungen des Geistes“, wie er sie zu nennen beliebt, übertragen.
Deshalb sollte man sich weder seine weiteren Auslassungen über die Wirkung des Weines entgehen und durch den Kopf gehen lassen – zumal sie literarische Kabinettsstückchen vom Feinsten sind, an köstlicher Ironie nicht zu überbieten – noch seine Reflexionen über die Notwendigkeit einer genauen Definition von Trunkenheit, angesichts der Tatsache, dass es Leute gibt, die behaupten „von einem Beefsteak betrunken“gewesen zu sein. Genauso seine Anregungen, Zeitpunkt, Häufigkeit und Umstände der „gelegentlichen Entspannung“ sorgfältig überdacht festzulegen, um optimale Ergebnisse erzielen zu können. „Das war“ – in der Zeit zwischen 1804 und 1812 – „selten öfter als einmal in drei Wochen, denn damals konnte ich mir es nicht erlauben, jeden Tag »ein Glas Laudanum-Glühwein, heiß und ohne Zucker« zu bestellen (wie ich es später tat). Nein einmal in drei Wochen genügten.“ An einem der ausgewählten Tage fand jeweils eine Opernaufführung mit einer von ihm besonders verehrten Sängerin statt: „Vor Erwartung zitternd, saß ich da, wenn die Zeit ihrer goldenen Erscheinung herankam, zitternd erhob ich mich von meinem Sitz, ohne ruhig bleiben zu können, wenn diese himmlische, harfengleiche Stimme mit ihrem präludierenden threttànelo – threttànelo ihr eigenes siegreiches Willkommen darbrachte. Die Chöre waren göttlich zu hören.“ Selbst seine Abschweifungen zum Beispiel über Wesen und Charakter von Musik erhellen den Geist, vor allem wenn man ihn ein wenig konditioniert hat. So erwiderte er einem Freund, der klagte, er könne mit Musik keine Gedanken verbinden: „Gedanken, lieber Freund! Sie haben hier keinen Platz; alle Gedanken, die in einem solchen Fall möglich sind, werden durch die Sprache symbolischer Gefühle ausgedrückt. … Es genügt hier zu sagen, dass ein Chor usw. von kunstvoller Harmonie vor mir wie auf einem Gobelin mein ganzes bisheriges Leben ausbreitete – nicht wie in einer Erinnerung an Vergangenes, sondern als etwas Gegenwärtiges, das die Musik verkörpert.“
Die ganze Bandbreite dieses menschenfreundlichen Geistes ermisst sich an dem anderen gesellschaftlichen Ereignis – mit dem ich so voll sympathisierte – dass er zum Anlass nahm Opium zu nehmen, um das Erlebte so intensiv wie möglich wahrnehmen zu können: „Ich pflegte … zu den Märkten und anderen Teilen Londons zu gehen, wohin sich die Armen an einem Samstagabend begeben, um ihren Lohn auszugeben. Ich habe vielen Familien, die aus Mann, Frau und manchmal einem oder zwei ihrer Kinder bestanden, zugehört, wenn sie über ihre Verhältnisse und Mittel, über die Stärke ihrer Kasse oder über den Preis von Haushaltsartikeln beratschlagten. Schrittweise lernte ich ihre Wünsche, ihre Schwierigkeiten und ihre Ansichten kennen. … Allgemein gesprochen hatte ich den Eindruck, dass die Armen philosophischer sind als die Reichen, dass sie sich bereitwilliger und freudiger dem unterwerfen, was sie als unabänderliches Übel oder unersetzlichen Verlust betrachten.“
Thomas de Quincey ist ein mit allen Wassern der Leichtigkeit, der Ironie, des freien Fließenlassens gewaschener Philosoph der Lebensfreude und des Genusses. Man kann mit ihm in die Tiefe gehen, ohne schwer zu werden, man kann sich von ihm fesseln lassen, ohne gebunden zu sein, man kann sich von ihm anstecken lassen, ohne krank zu werden.
Wer das nicht tut, ist selber schuld.
Christof Wackernagel
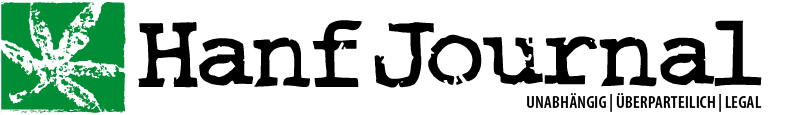















Geh weida.
Klar, Opium und Cannabis besser als Wein, aber wer wirklicher Zen-Meister ist, braucht nicht einmal mehr das.
Ich mache mich auf den Weg dahin und werde solange noch das ein oder andere Tütchen futtern.
Grüße
X