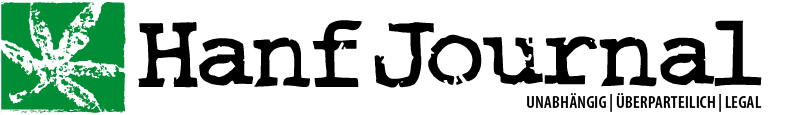Thema: Hanf und Sucht
Wir wollen natürlich nicht verschweigen, dass insbesondere der regelmäßige Konsum von Hanfblüten auch das Risiko der Abhängigkeit in sich birgt. Regelmäßiger Cannabiskonsum kann zu einer psychischen sowie leichten körperlichen Abhängigkeit führen:
Kennzeichnend hierfür sind erfolglose Versuche, den Konsum zu reduzieren oder einzuschränken. Bei Cannabisabhängigkeit sind Abstinenzversuche begleitet von innerer Unruhe, Nervosität oder Depressionen sowie Schlafproblemen. Studien gehen davon aus, dass jedoch nur vier bis sieben Prozent aller Cannabiskonsumenten ein Abhängigkeitsmuster entwickeln.
Die Gefahr einer Abhängigkeit ist jedoch individuell sehr verschieden, vor allen Dingen psycho-soziale Risikofaktoren geben den Ausschlag, ob ein Mensch mehr oder weniger „gefährdet“ ist.
Die wichtigsten Risikofaktoren sind:
ein frühes Einstiegsalter (unter 16 Jahre)
mangelnde soziale Unterstützung
allgemeine Perspektivlosikkeit (fehlender Schulabschluss, Arbeitslosigkeit o.ä.)
kritische Lebensereignisse (Trennung o.ä.)
ein früher Einstieg in die so genanten „legalen“ Drogen Alkohol und Nikotin
eine allgemein labile Psyche
Die Einstiegsdrogentheorie:
Auch galt Cannabis im letzen Jahrhundert noch als „Einstiegsdroge“, diese Theorie ist mittlerweile eindeutig widerlegt: Weil fast alle Heroin-oder Kokainabhängigen auch irgendwann einmal Cannabis konsumiert haben, galt die lange als Beleg der „Einstiegsdrogentheorie“.
Langzeitstudien und die allgemeine gesellschaftliche Entwicklung haben gezeigt, dass nur ein sehr kleiner Prozentsatz der Hanfkonsumenten auf harte Drogen umsteigt. Mittlerweile gilt diese Theorie in Fachkreisen als eindeutig widerlegt.
Cannabis und Schizophrenie:
Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen gibt es keine „Cannabis-Schizophrenie“. Etwa ein Prozent der Bevölkerung ist grundsätzlich von Schizophrenie bedroht. Man vermutet, dass unter den an Schizophrenie erkrankten Personen mehr Cannabispatienten zu finden sind als im Bevölkerungsdurchschnitt, weil diese die entspannende Wirkung nutzen. Allerdings kann Cannabis den Krankheitsverlauf negativ beeinflussen, den Zeitpunkt des Ausbruchs beschleunigen und die Anzahl der Schübe erhöhen. Deshalb ist der Gebrauch von Cannabis für Betroffene oder Gefährdete nicht zu empfehlen.
All diese Gefahren werden bei einer anhaltenden Kriminalsierung von Cannabis noch intensiviert, da insbesondere der Jugendschutz nicht über einen Schwarzmarkt in den Griff zu bekommen ist.
Ähnliches gilt für die Suchtprävention. Das wichtigste Instrument zum Umgang mit Drogen kann nur funktionieren, wenn es, wie das Wort sagt, der Sucht vorbeugt.
„Es gilt heute als wissenschaftlich akzeptiert, dass bestimmte Formen des Konsums psychoaktiver Substanzen durchaus mit physischer, psychischer und sozialer Gesundheit vereinbar sind“* Genau diese Erfahrung machen Monat für Monat Hundertausende Schweizer und SchweizerInnen…
Deshalb kann eine Vorbeugung nur dann greifen, wenn der Staat seine Programme auf genau die vier bis sieben Prozent der Konsumenten mit problematischem Konsummuster abstimmt, anstatt alle Hanfkonsumenten zu stigmatisieren.
Das ist nur dann möglich, wenn die restlichen 95 Prozent aus der Schusslinie genommen werden und das Image des Outlaws ablegen können.
Wer am 30. November mit „Ja“ stimmt meint es ernst mit Jugendschutz, Aufklärung und Suchtprävention.
*(Prof. Dr. Dieter Kleiber in „Cannabiskonsum. Entwicklungstendenzen, Konsummuster und Risiken“ – 256 Seiten, Juventa Verlag, Weinheim
ISBN: 3779911779)