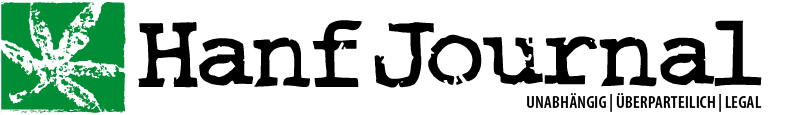Peter Cohen in Heidelberg
Eine öffentliche Vortragsreihe am Fachbereich Medizinische
Psychologie der Universität Heidelberg beschäftigt sich gegenwärtig mit dem
Thema „Rausch und Ritual“. Im Rahmen dieser Reihe war am 14. Juli der Soziologe
Peter Cohen zu Gast in der Uni-Stadt. Cohen war lange Jahre Leiter des
Amsterdamer Instituts für Drogenforschung (CEDRO). Dort war er bereits in den
70er-Jahren an der Entwicklung des bekannten holländischen Coffee Shop-Modells
beteiligt, für das Kiffer in aller Welt bis heute dankbar sind. Und noch immer
ist er in seinem Forschungsbereich sehr aktiv und gilt hierzu als einer der
kompetentesten und spannendsten Referenten Europas.
Cohens wurde begrüßt durch die Gastgeber Prof. Rolf Verres
und Dr. Henrik Jungaberle. Unter den zahlreichen Gästen befanden sich u. a.
Tilmann Holzer, Vorsitzender des VfD und der Autor und Verleger Werner Pieper.
Cohen begann seinen Vortrag mit einer Frage, die zunächst
einfach klingt, es aber in sich hat: „Woher wissen wir, dass Drogenpolitik
Effekte auf die Prävalenz hat?“ Prävalenz gibt dabei die Anzahl der Menschen
an, die in ihrem Leben, dem letzten Jahr oder letzten Monat Drogen konsumiert
hat und wird deshalb in Lebenszeit-, Jahres- und Monats-Prävalenz unterteilt.
Der Eingangsfrage stellte Cohen denn auch gleich seine Kernthese gegenüber:
Drogenpolitik habe keine Effekte auf die Prävalenz, sei also für die Anzahl der
Drogenkonsumenten irrelevant. Diese These sei erstmalig bereits Anfang der
80er-Jahre durch den Kölner Professor Karl Heinz Reuband aufgestellt worden.
Allerdings sind erst in der neuesten Zeit umfangreiche empirische
Untersuchungen dazu durchgeführt worden, von welchen Cohen im Folgenden zwei
Beispiele vorstellte.
Im ersten Fall handelt es sich um quantitative
Untersuchungen zur Drogenprävalenz in den USA und den Niederlanden. Dabei
stellte er Cannabis in den Vordergrund, ist hier doch der drogenpolitische
Unterschied am offensichtlichsten. Verglichen wurden so z. B. die Werte der
Lebenszeitprävalenz in den Jahren 1997 und 2001. In der Gesamtbevölkerung nahm
in diesem Zeitraum der Anteil der Cannabis-Erfahrenen in den USA von 33 auf 38
Prozent zu. In den Niederlanden stieg dieser Wert lediglich von 17 auf 18
Prozent an. Besonders interessant war in diesem Zusammenhang die Gruppe der
Minderjährigen von zwölf bis 17 Jahren. Während in dieser Altersgruppe der
Anteil der Cannabis-Erfahrenen in den Niederlanden von 14 auf elf Prozent sank,
blieb er in den USA konstant bei 20 Prozent. In den USA hat somit jeder fünfte
Jugendliche schon mal gekifft, in den Niederlanden nur jeder zehnte. Dieser
etwa doppelt so hohe Anteil an Kiffern zeigte sich auch bei der Monatsprävalenz.
Bei dieser Erhebung des aktuellen Cannabis-Konsums lagen die Werte bei
sechsProzent in den USA und in den Niederlanden bei drei Prozent. Hat nun das
Cannabis-Verbot in den USA die Anzahl der Kiffer reduziert? Offensichtlich
nicht. Daraus allerdings abzuleiten, dass die Cannabis-Tolerierung in den
Niederlanden zu vermindertem Cannabis-Konsum führe, sei nach Cohen aber auch
nicht zulässig. Beim Alkohol z. B. liegen die Prävalenz-Werte in den
Niederlanden relativ konstant bei etwa 90 Prozent, in den USA bei knapp über 80
– obwohl das Alkoholregime dort etwas strenger ist als in dem kleinen Land
zwischen Rotterdam und Groningen.
Die daraus abgeleitete These, wonach die Prävalenz
wahrscheinlich unabhängig von der Drogenpolitik sei, wurde auch in der
anschließenden Diskussion von verschiedener Seite bestätigt. So wurde
vorgebracht, dass die schärfsten Anti-Drogengesetze der EU in Schweden und
Frankreich herrschten. Allerdings sei Schweden neben Portugal und Griechenland
das europäische Land mit dem geringsten Cannabis-Konsum, während nirgends in
der EU so viel gekifft würde wie in Frankreich. Die Gesetze der Drogenpolitiker
könnten also nicht das ausschlaggebende Kriterium für Drogengebrauch sein.
Vielmehr stellte Peter Cohen die These auf, dass aller
Wahrscheinlichkeit nach historisch gewachsene kulturelle Einstellungen und
Werte die Rolle und somit die Verbreitung von Drogen bestimmen. Zur
Untermauerung dieser These stellte er eine aktuelle vergleichende qualitative
Studie zum Drogengebrauch in Bremen, Amsterdam und San Francisco vor – drei
Städte mit sehr unterschiedlichem rechtlichem Umgang mit Drogen. Für diese
Studie wurden Interviews mit Drogenbebrauchern zu ihrem Konsum, ihrer sozialen
Lage, ihren Einstellungen und vielen anderen Dingen geführt. Die Ergebnisse zu
Cannabis, Kokain und Amphetamin befinden sich seit kurzem auf der Homepage des
Amsterdamer Drogenforschungsinstituts CEDRO.
Die Antworten und Ergebnismuster sind in allen drei Städten
fast identisch. So wissen die Konsumenten z. B. von Cannabis sehr viel über
ihren Konsum, sind sich dessen aber nur relativ wenig bewusst. Die
drogenpolitischen Unterschiede sind für die Entscheidung zum Drogenkonsum
unerheblich. Vielmehr steht die Funktionalität des Konsums stets im
Vordergrund. Es geht den Konsumenten auf der einen Seite um eine psychische
Funktion, z. B. Entspannung, und auf der anderen Seite um eine soziale
Funktion. Durch den Drogenkonsum werden soziale Riten entwickelt, die Gruppen
konstituieren: „Mit diesen Leuten wird gekifft, mit jenen Bier getrunken und
mit anderen werden keine Drogen gemeinsam genommen.“ Zudem stellt der
Drogengebrauch neben vielem anderen einen sozialen Status dar. So, wie beim
Essen die Beigabe eines guten Weines eine Aussage zum Status markiert, findet
sich das auch, wenn ein edler Whisky präsentiert, eine kleine Line guten
kolumbianischen Kokains gesnifft oder der Sieger des letzen Cannabis-Cups
geraucht wird. Immer lauten implizite Aussagen: „Ich habe hier was Besonderes“
und „Ich teile es mit dir (bzw. euch)“. Die nicht-klinischen Konsumenten – also
die große Mehrheit – baut der Studie zufolge kein problematisches, sondern ein
funktionelles Verhältnis zu Drogen auf. Dies zeichnet sich durch eine Vielzahl
sozialer Kontexte aus. Diese Kontexte stellen dabei eine wichtige Quelle zur
Normierung des Drogengebrauchs dar.
Die Bedeutung des jeweiligen Kontextes sei Cohen zufolge
nicht hoch genug für Konsumhäufigkeit und -muster zu veranschlagen: „Kontext
ist ein unglaublich wichtiges Element, ob Probleme auftreten oder nicht.“ Er
machte dies an einem Beispiel deutlich. Es ist ein wichtiger Teil unserer
Alkohol-Kultur, dass wir unseren Kindern zeigen: Wir trinken Alkohol. Dadurch
ist Alkohol kein Tabu-Thema, was Kommunikation zu diesem Thema erst ermöglicht.
Andererseits findet sich heute eine neue Tendenz, Alkohol vor den Kindern zu
verstecken. Darin sieht Cohen einen Fehler, denn die Entkulturation führe zu
höheren Abhängigkeitsraten. Unproblematischen Alkoholgebrauch der Älteren zu
tabuisieren erhöhe die Wahrscheinlichkeit problematischen Konsums bei den
Jüngeren. Diese Erkenntnis, so Cohen, sei auch für andere Drogen nötig.
Allerdings würde eine solche Offenheit durch Drogenverbote verunmöglicht.
Deshalb plädierte Cohen: „Ich bin für einen legalen Zugang zu allen Drogen“ und
an anderer Stelle: „Kriminalisierung ist ein Feind von Solidarität mit den
Schwächeren.“ Dabei, so Cohen, sollte in der Ausgestaltung die jeweilige lokale
Kultur die lokalen Regelungen bestimmen.