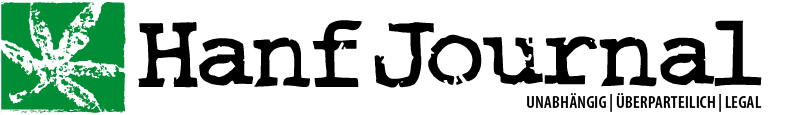das ist hier die Frage
Cannabisliebhaber, die nach nüchternem Tagwerk die Beine hochschlagen und sich die Stunde des Feierabends mit einer kleinen Tüte versüßen, kennen es allzu gut:Plötzlich sind sie da, die neckischen Geister, die im Kopf herumspuken und Schabernack mit uns treiben. Das ist die Stunde der Inspiration, wenn die Hefe des Denkens gärt und selbst dem größten Armleuchter ein Licht aufgeht.
Lieben Sie Shakespeare – den großen Dramatiker und Schöpfer der Tragödie „Romeo und Julia“? Wenn ja, dann sollten Sie wissen, dass sich seine Gebeine neulich im Grabe umgedreht haben, weil man den berühmtesten Sohn Englands posthum als Haschischraucher denunzieren will. Anthropologen wollen nämlich die letzte Ruhestätte des mutmaßlichen Hochleistungskiffers in Stratford öffnen und ein Drogenscreening durchführen. Anlass der Leichenfledderei gaben vierhundert Jahre alte Tonpfeifen, die sich bei der Sanierung des Geburtshauses des Meisters anfanden und somit ein untrügliches Indiz dafür sind, dass der gute William beim Dichten und Denken gedopt war. Das ist natürlich ziemlich starker Tobak für die Shakespeare-Freaks, und der Streit um die wahre Identität des dichtenden Phantoms entgleist zusehends zu einem skurrilen Medienspektakel der britischen Regenbogenpresse.
5000 Jahre Rauschkultur minus ein paar Jährchen Drogenprohibition haben in Bibliotheken, Museen und Archiven ihre Spuren hinterlassen. Unsere Alt-Künstler leuchteten mittels psychoaktiver Substanzen gerne die dunkelsten Ecken ihrer Seele aus, um als Grenzgänger zwischen Genie und Wahnsinn auch noch den letzten Rest Phantasie und Kreativität herauszukitzeln. Die Ahnentafel der schöpferischen Suchtlappen führt große Namen an, vorneweg der Herr im Himmel, der den ersten Menschen zweifelsfrei im Delirium geschaffen haben muss. Wie sonst erklärt sich Adams Blutrausch, sich mit bloßer Hand eine Rippe aus der Brust zu reißen, um sich daraus eine Gespielin zu klonen? Und die lässt der Allvater auch noch drogensüchtig werden, weil die Dame aus Langeweile in die verbotene Frucht beißt.
Folgt man dieser Logik, dann sind Drogen gottgewollt und der Rausch gehört zum Leben des Menschen wie die Luft zum Atmen. Ob im alten Persien oder modernen Rom, gedröhnt wurde zu allen Zeiten. Das Menschgeschlecht hat überlebt, aber nicht trotz, sondern dank der vielen fleißigen Giftmischerinnen, die für jeden Geschmack das passende Elixier brauten. Noch heute gilt die alte Zauberformel, dass die Dosis das Gift macht. Verneigen wir uns also vor Mutter Natur, die ihre Kinder in einem Kräutergarten voller Wunder aufwachsen lässt – weil sie es gut mit uns meint.
Vor allem die Literaten waren seinerzeit tüchtig am Giften. Geradezu professionell betäubte sich der Shakespeare-Nachahmer Johann Wolfgang von Goethe, der seinem Sekretär Eckermann im Vollsuff das diktierte, was ihm im Laudanum-Rausch in den Sinn gekommen war. Doch auch richtige Geistesakrobaten wie der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel frönten dem Drogengenuss, der dem Schaffensrausch oftmals vorausging. In seiner Berliner Zeit soll der Schnupftabakfreund, so der Hegelianer Heiner Höfener, während der Vorlesungen so ausgiebig gesnieft haben, dass die Haschbrösel auf dem Katheder ausreichten, um anschließend die Studenten high zu machen. Der Vordenker (des Marxismus) befand sich dauerhaft in euphorisiertem Zustand, der vor allem durch körpereigne Opiate befeuert wurde, die der Marathonlauf der völligen Vergeistigung nun einmal mit sich bringt.
Davon konnte auch Friedrich Nietzsche ein Lied singen: Auf der Suche nach dem Übermenschen verlor Deutschlands letzter Super-Philosoph komplett die Orientierung in der Fröhlichen Wissenschaft und irrte bis zum letzten Atemzug durch die einsame Welt der geistigen Umnachtung. Hätte er mal besser auf die eigenen Worte seiner rauschhaften Sprachgewalt gehört: „Wenn man von einem unerträglichen Druck loskommen will, so hat man Haschisch nötig. Wohlan, ich hatte Wagner nötig.“ Zuletzt bedauerte Nietzsche zutiefst seine kranke Optik auf das Wagnerianertum, deren Jünger bis heute alljährlich nach Bayreuth pilgern, um sich mittels der schwülen Atmosphäre des schwermütigen Richard-Wagner-Rituals in einen sinnbetörenden Trance zu versetzen – der auch schon mal zu spontanem Suizid verführt.
Nun wäre es jedoch irreführend anzunehmen, dass die Kunstschaffenden vorangegangener Epochen vierundzwanzig Stunden am Tag Dionysos und Shiva gehuldigt hätten. Den zumeist rational denkenden Genussmenschen von damals ging es nicht darum, das mühselig mit Wissen gefütterte Gehirn in Cognac einzulegen und im Vollrausch für den Papierkorb zu schreiben. Wie in Südeuropa üblich war der gepflegte Schoppen zum Mittagessen obligatorisch, und da man schon einmal dabei war und die Kunst mit erhöhtem Blutdruck besser von der Hand ging, hielt eben der Schwips den Grips bis zum Schlafengehen auf Betriebstemperatur. Immanuel Kant musste nicht wie ein Loch saufen, denn er hatte den Mut, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen – vor allem aber war das Professorchen sich selbst Rausch genug.
Dass der Weintrinker überdies mit psychogenen Substanzen hantierte, lag wohl mehr daran, dass sie frei verfügbar waren und als Hausmittelchen noch jede Krankheit kurierten. „Gut essen und trinken ist die wahre Metaphysik des Lebens“, war des Schluckspechts kategorischer Imperativ, wenn er nachts um die Häuser zog und von einem Strudel gesellschaftlicher Zerstreuungen fortgerissen wurde. Dazu zählte unter anderem das gewinnorientierte Zocken mit Karten und Billardkugeln in den Salons der Bohème, womit der Kritiker der reinen Vernunft eindeutig ein Fall für die Drogenbeauftragte der deutschen Bundesregierung wäre, die neben Trinkern und Rauchern auch den Spielsüchtigen das Laster austreiben will.
In den Augen der selbsternannten Gesundheitsapostel unserer Zeit hatten Edgar Allan Poe und Oscar Wilde ein schweres Suchtproblem. Auch Toulouse-Lautrec, Gaugin und van Gogh wird angekreidet, die Welt nur durch die rosarote Brille des Drogenrauschs abgemalt zu haben. Dagegen kämpfte Ernest Hemingway zeit seines Säuferlebens mit Absinth gegen die Trinksucht an, während Hans Fallada streng polytoxikoman unterwegs war, wenn er nicht gerade im Schaffensrauschs auf Wolke Sieben schwebte. Das Who’s Who der drogensüchtigen Bildungselite der letzten Jahrhunderte entspräche heute dem Insassenregister einer Justizvollzugsanstalt.
Allzu menschlich also, wenn die Puristen zum Schutze der Jugend nach Zensur kreischen. Mark Twains Klassiker „Huckleberry Finn“ ist so ein Beispiel, wie politische Korrektheit Filmemacher dazu zwingt, den Abenteuerroman bis zur Unkenntlichkeit zu verhunzen. Statt des sympathischen Faulenzers, der raucht, säuft und von den Reichen nimmt, wird ein braver gottesfürchtiger Streber mit Justin-Bieber-Frisur vor die Linse gestellt, der mit Mark Twains jugendlichen Alter Ego so viel gemein hat wie der Papst mit einem indischen Bettelmönch. In Zeiten des Tugendterrors taugt ein drogensüchtiger, niggerfreundlicher Trebegänger nicht als Kinoheld für unsere vaterlose Wohlstandsjugend, die paradoxerweise mit vielen bunten Pillen und Kindermilchschnitten funktionsfähig und zugleich körperlich wie geistig unbeweglich gehalten wird. Der Auftrag an die Künstler ist, das Sittengemälde einer sachlichen und auf Substanz-Askese ausgerichteten Gesellschaft zu malen.
Doch sind Künstler noch Künstler, wenn sie nur noch im fragilen Räderwerk einer gleichgeschalteten Gesellschaft ohne große Reibungsverluste mitlaufen und stereotype Gefälligkeitskunst produzieren? Bedarf es nicht der ständigen Grenzüberschreitung, um dem Anspruch an die Wahrheit von Kunst und Wissenschaft gerecht zu werden?
Nun gut, noch hat uns die Zukunft nicht eingeholt, und selbst unsere angestaubten Dichter und Denker würden voll auf ihre Kosten kommen. Charles Baudelaire und Victor Hugo könnten nahtlos an die alte Drogenkarriere anknüpfen. Nur in der Kunst hätten es die Kollegen von damals um einiges schwerer, denn auf dem modernen Medienmenschen lastet der Fluch der Eilfertigkeit. Alles muss schnell und zügig vonstatten gehen, und nur die kommen an den Fressnapf, die sich stromlinienförmig durchs Leben schlängeln und voller Inbrunst der Zeit und Mode dienen. Die geistige Elite unserer Tage verträgt kein Haschisch und Opium, denn wer das Tempo aus seiner Künstlerkarriere nimmt, bleibt auf der Strecke. Doktorhüte zieren heute andere Köpfe, deren Besitzer es mit den Geisteswissenschaften aus Mangel an Esprit nicht so genau nehmen. Die Nachhaltigkeit des Werkes spielt keine Rolle, denn einzig der Profit misst den Wert der geistigen Ausdünstung.
Ein Hegel könnte gegen die Auftragsdenker unserer Mediendiktatur mit der Haschpiepe nicht anstinken. Nein, Hegel geht gar nicht! Ein Professor im Hörsaal der Goethe-Universität in Frankfurt, der sich vor den Facebook-Augen der überwiegend weiblichen Burschenschaft Haschgift in die Nase spritzt und dazu über Triebe und Glückseligkeit twittert, würde keine vierundzwanzig Stunden den Doktorhut tragen. Ebenso wenig Nietzsche, der nur noch als Vollpfosten für eine Talkshow gecastet würde – Titel der Sendung: Das richten Drogen und zu vieles Denken an. Als Stargast mit dabei und extra aus England angereist, das von Haschisch zerfressene Skelett des guten alten Shakespeare.