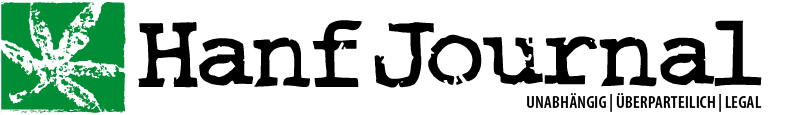Überlebensratgeber für Westafrika von Christof Wackernagel

Afrika, Kontinent des Elends und der Lebensfreude. Mali, das Herz Westafrikas, eines der ärmsten Länder der Welt, kulturell das reichste. Malis Hauptstadt Bamako, Ausrichter einer international beachteten Foto-Biennale, vor allem aber das Mekka der Weltmusik. Ob Bono, Ginger Baker oder Paul Mc Cartney: alle pilgern sie nach Mali, um in Studios in Bamako mit Ali Farka Touré, Oumou Sangaré oder Toumani Diabaté Sessions zu machen und CD’s einzuspielen. Oder um mit Bassekou Koujaté, Habib Koité oder Nahawa Doumbia auf Festivals in Segou, der Hauptstadt Westafrikas vor der Kolonisierung durch erst die Araber dann Europäer, oder Timbouctou, der legendären mittelalterlichen Tuareg-Universitätsstadt, die Zentrum des Salz- und Goldkarawanenhandels war, auf international gefeierten Festivals zu spielen.
Künstler dieser Kategorie leben in Luxushotels und werden dort von ihren Managern und Roadies mit den Schönheiten und Genussmitteln des Landes versorgt – was aber machst du als anonymer Durchschnittstourist, der einfach nur mit der Bevölkerung in Kontakt kommen will, oder gar mit seiner Klampfe in einer schattigen Ecke sich zu ein paar Musikern setzen und mit ihnen jammen will, die gerade Ballaphon, Ngoni oder Djembe spielen? »Me too« feiert auch in Mali seine Konjunktur und mit den Rauchwölkchen, die die Welt so schön machen, ist es ein bisschen wie in Nordrhein-Westfalen: nicht richtig verboten, aber auch nicht richtig erlaubt. Da ist guter Rat teuer – hier kommt er:
Was die Schönheiten betrifft, ist die Sache einfach, denn zwischen Männern und Frauen gibt es weder Landes- noch Sprachgrenzen und gerade die malischen Frauen verstehen wie wenig andere die Kunst der nonverbalen Eindeutigkeit. Ein Blick und du weißt: »no chance«, vielleicht sogar »verpiss dich, Alter!«, oder eben eine mit einem Augenaufschlag verbundene Kopfbewegung und du weißt: »lass mal deine Telefonnummer rüberwachsen«. Und sollte dies vielleicht sogar mit einer dazu passenden hinterteiligen Bewegung verbunden sein, darfst du jetzt nichts falsch machen: bloß nicht drängeln! So tun, als bräuchte man nur Hilfe für eine Busverbindung oder ein wenig Sprachunterricht, den man(n) auch durchaus zu entlohnen bereit wäre. Also das normalste Geschäft der Welt. Und wenn du es dann geschafft hast, dass sie zu Dir in die Bude kommt: Finger weg beim ersten Mal! Keine Andeutung, nichts! Denn wenn sie dich dann zum zweiten Mal besuchen sollte – kann es direkt zur Sache gehen. Etwas schwieriger wird es bei den Genussmitteln, ohne die (jedenfalls keine Welt-) Musik zustande kommt.
In diesen Ländern, die man früher »Drittweltländer« nannte, heute eher »arme Länder« (was nicht stimmt, denn es gibt unermesslichen Reichtum in diesen Ländern, nur eben in den Händen weniger, die keine Steuern zahlen, ihre Mätressen mit Business-Class nach Paris zum Shoppen schicken und im Luxus baden, während die überwiegende Anzahl ihrer Landsleute in unermesslicher Armut neben ihnen verreckt), gibt es zwei Anlaufpunkte, bei denen man mit Sicherheit alles findet, was der verwöhnte Durchschnittseuropäer braucht. Perrier Kohlensäurewasser, original Schweizer Emmentaler oder – vor allem in muslimischen Ländern sensibel zu behandeln – Alkohol etc.: internationale Luxushotels und Supermärkte.
Von den Luxushotels rate ich entschieden ab: zu teuer! Da dort vor allem weiße oder eben reiche Ausländer verkehren, die von den Preisen keine Ahnung haben, kann das Gramm fünf- bis zehnmal so teuer werden und Diskussionen werden gar nicht erst angefangen, da die Dealer gewohnt sind, ihre Preise zu bekommen.
Anders vor den Supermärkten. Hier kaufen genau diese reichen Schweine ein, die davon leben, ihre Landsleute so auszunehmen, dass diese lieber auf der Flucht im Mittelmeer krepieren als neben den Palästen dieser Herrschaften zu verhungern. Dieser Menschenschlag ist so geizig, dass er lieber auf etwas verzichtet als einen Cent zu viel zu zahlen; handelt so hart, dass sein Gegenüber erst gar nicht versucht, mehr rauszuholen, und wenn er es für nötig hält, droht er mit seinen polizeilich juristischen Kontakten.
Um die Supermärkte herum haben sich überall Frauen an Ständen gruppiert, die frisches Obst verkaufen, oder fliegende Händler, die Zigaretten, Alkohol, Raubkopien von CDs/DVDs mit Musik oder Pornos anbieten – und eben auch das weltweit so beliebte und begehrte grüne Kraut.
Letztere lassen dich nicht ungeschoren aus dem Supermarkt kommen. Vor allem die Raubkopien sind so sensationell billiger als die Originale, dass du schon hart zu seiner Solidarität mit den Musikern stehen musst, um nicht schwach zu werden. Aber auf diese Weise seid ihr schon mal ins Gespräch gekommen. Wenn du dann so ganz nebensächlich die Frage fallen lässt, wie es denn mit »was zu rauchen« wäre, stellt sich dein Gegenüber erst einmal dumm. Er weiß zwar genau, dass damit nicht die Raubkopie-Zigaretten gemeint sind, die er ebenfalls verkauft (wie Raubkopie-Markenzahnpasta oder Tempotaschentücher), es wehen zwar dem Flaneur, der durch Bamako zieht, an jeder dritten Ecke süße Düfte um die Nase – und die roten Äuglein vieler Menschen rühren auch nicht unbedingt von der großen Hitze her – der Kollege weiß zwar, was du von ihm willst, will aber eine klare Ansage.
Wenn du also zufälligerweise eines Tages in Bamakos schönem Stadtteil Hippodrome in der Rue Nelson Mandela bei dem – wie alle Supermärkte – von einem libanesischen Ehepaar geführten »Miniprix« den besten Parmesan der Welt außerhalb von Italien (ohne Übertreibung, dafür lohnt es sich, nach Bamako zu fliegen) holen willst – weil du Gier nach Spaghetti alio-olio hast – kann es dir passieren, dass du links neben dem Eingang, direkt vor den großen, mit schweren Eisengittern diebstahlgesicherten Klimaanlagenmotoren, einen jungen Mann seinen Gebetsteppich ausrollen siehst, auf den er dann schwungvoll seine schweißnasse Stirn unter dem gestrickten Gebetskäppi presst und dabei seine Suren flüstert.
Verlässt du gut gelaunt den Laden – weil der Parmesan vorrätig war, was nicht immer der Fall ist, gibt auch ersatzweise keine mindere Qualität – empfängt derselbe junge Mann dich strahlend und bietet dir eine Hundertprozent-Nicht-Raubkopie der neuesten CD von Salif Keita an. Er weist auf das kleine silberne Viereck von der BUMDA, der malischen Partnerorganisation der deutschen GEMA hin, die der Beweis dafür sei, und bietet sie dir, weil du ja schon jahrelang sein Freund bist – und überhaupt ein so sympathischer Mensch, dass du fast ein Muslim sein könntest – deutlich unter dem offiziellen Handelspreis an. Sollest du schwach werden, rate ich dir, das kleine silberne Dreieck etwas genauer zu untersuchen: es müsste ein glänzender Aufkleber sein – du wirst aber mit Sicherheit feststellen, dass es matt ist und kein Aufkleber, sondern vom Original gescannt und: raubgedruckt. Sei nun ehrlich enttäuscht oder spiele es zumindest überzeugend: wie kann man eine Freundschaft so missbrauchen, du lässt doch mit dir über alles reden und dann ein derart platter Betrugsversuch: das geht gar nicht!
Als nächstes wundere dich, dass er es wagt, Salif Keita zu linken, denn kein Musiker in ganz Mali verfolgt so hart die fliegenden Raubkopie-Händler (nur dieses Händler: die gut eingesessenen Hersteller sind dieselben, die die Originale produzieren, und in ihren Firmen sind an jeder Tür Aufkleber zu sehen: »Kampf den Raubkopien«). Aber du würdest ja den guten Sidi niemals der Polizei verraten, allein schon weil er Dogon ist und die Dogon von der UNO zum Weltkulturerbe ernannt wurden und außerdem deine Freundin auch eine Dogon ist, und dies die Frauen in Mali sind, die es – neben den Peulh – am besten können – aber eigentlich kannst du so etwas mit deinem moralischen Selbstverständnis nicht vereinbaren.
Denn jetzt hast du ihn am Wickel und jetzt kannst du – »unter uns Betschwestern« – die eigentliche Krautfrage stellen. Denn erstens hat er etwas wieder gut zu machen und zweitens kann er etwas verkaufen. Was ist ihm letztlich egal.
»Pas de probleme«, »kein Problem«, kommt wie aus der Pistole geschossen – was nicht viel sagt, denn dieser Spruch kommt vor allem dann garantiert, wenn etwas Probleme macht – und darauf die zentrale Frage: für wie viel?
Schlage dann auf keinen Fall mehr als 5000 Frcfa vor, das sind etwa acht Euro. Der CFA-Franc ist die westafrikanische Einheitswährung für 22 Länder, ähnlich unser Euro und mit festem Wechselkurs – über Frankreich – an ihn gebunden. Wie überhaupt in ganz Westafrika: Nichts geht ohne die Franzosen. Aber so weiß man wenigstens, woran man ist. 5000 sind für den Durchschnittsmalier viel Geld – eine Putzfrau verdient das im Monat, mehr zu bestellen, hieße den reichen Macker raushängen zu lassen, was den Preis erhöhen würde.
»Pas de probleme« erschallt es daraufhin erfreut: morgen, gleiche Zeit, gleicher Ort.
Bilde dir jetzt aber bitte bloß nicht ein, du könntest morgen kommen, dein Gras in Empfang nehmen, bezahlen und gehen – ausmachen ist das eine, ausführen etwas ganz anderes.
Sidi ist zwar da, schüttelt aber betrübt den Kopf, sobald er dich entdeckt hat. Er stürmt auch nicht auf dich zu, er bietet dir keine CDs an, er will auch nicht über die unvergleichlichen Dogon Frauen reden – er bleibt, den Kopf in die Hände gestützt, auf seinem Hinkelstein sitzen, den irgendein Obelix mal bis hierhin geworfen hat, und ist verzweifelt. »In ganz Bamako gibt es kein Gramm Gras, völlig unverständlich«. Er habe seit gestern nichts anderes getan, als etwas aufzutreiben, »rien ne va plus«! Du ahnst zwar, dass da was faul ist, bleibst aber ganz ruhig, da du keine Anzahlung machen musstest. Vor allem zeigst du keinerlei Enttäuschung oder Frust, sondern sagst: »Naja, behalts im Kopf, vielleicht ein andermal« und wendest dich zum Gehen.
»Halt«, wird dann eine Stimme hinter dir ertönen, und während du dich wieder umdrehst, siehst du einen nachdenklichen Sidi aufstehen. Er kommt zu dir, legt den Arm um dich und führt dich um die Ecke, wo niemand euch sieht. Mehrmals setzt er zum Sprechen an, mehrmals sieht er nach rechts und nach links, ob ihr beobachtet werdet, mehrmals schüttelt er den Kopf, doch dann sagt er: »Eben ist mir noch eine allerletzte Möglichkeit eingefallen«. Kunstpause, bedeutungsvoller Blick. Jetzt nicht reagieren, schon gar nicht erfreut, cool bleiben, fast desinteressiert. »Ich habe einen Freund ganz in der Nähe, den ich noch fragen könnte – kannst du fünf Minuten warten?«
Nun ist es wichtig, im Prinzip überhaupt gar keine Zeit zu haben, aber bereit zu sein, sie zu nehmen, damit der gute Sidi nicht leer ausgeht, nachdem er sich doch so bemüht hat. Dann nämlich ist er in weniger als zwei Minuten wieder da und bringt einen ernst und würdevoll einherschreitenden jungen Mann mit, der in einen grauen Kaftan – der in Mali Bubu genannt wird – gekleidet ist. Darauf folgt das so umständliche wie unvermeidlichen Kennlern- und Begrüßungsritual – dass es allen gut geht, inklusive Frau und Kindern.
Daraufhin lässt man sich vor den Klimaanlagenmotoren nieder, macht es sich gemütlich und der junge Graugekleidete zieht ein ungefähr zehn bis fünfzehn Zentimeter großes, in Zeitungspapier gewickeltes Quadrat unter seinem Bubu hervor und schält andächtig das Zeitungspapier ab. Darunter erscheint ein steinhart gepresster Graskanten, Samen gesprenkelt. Männerapartheid gibt es auch für Hanfpflanzen in Afrika eben nicht – dafür braucht man sich um den Nachwuchs nicht zu kümmern. »Scheiße«, denkst du, »das gibt ja eine endlose Popelei, die ganzen Samen da raus zu fieseln«; kannst den Gedanken aber nicht weiterführen, denn jetzt kommt der Zweck der Übung beziehungsweise der Inszenierung zur Sprache: »25 000« solle das kosten. Das wären etwa 40 Euro für eine Menge, die bei uns 400 kosten würde, aber so geht es natürlich nicht.
Ratlos ziehst du deinen 5000 Frcfa Schein aus der Tasche und sagst klagend: »mehr habe ich nicht, so war es ausgemacht!« – was berechtigterweise einen Lacherfolg erzielt.
Jeder weiß, dass der andere lügt, aber das gehört zum Spiel – und zu zeigen, dass man dieses Spiel mitzuspielen bereit ist, macht schon die halbe Miete aus. Der Handel muss genauso viel Spaß machen wie das Kaufen oder Verkaufen selbst. Wer nicht handelt, wird verachtet.
1. Grundgesetz: Wer anbietet, nennt den doppelten Preis, den er haben will; wer bietet, die Hälfte dessen, was er zu zahlen bereit ist.
2. Grundgesetz: Die Spannung besteht darin, welche Seite es schafft, mehr bzw. weniger als die 50% rauszuhandeln.
3. Grundgesetz: Jammern gehört zum Geschäft. Auch nachdem man sich geeinigt hat, ist Matthäi am Letzten: die Kinder werden verhungern, die Frau wird weglaufen, ein Weiterleben ist im Prinzip unmöglich!
Zu 1.: Der Verkäufer wusste, dass du 5000 geboten hattest, geht deshalb davon aus, dass du 10 000 zu zahlen bereit bist, versucht also 12 500 bei dir rauszuholen.
Zu 2. und 3.: »Ich habe fünf Kinder, wie soll ich die ernähren?« »Selber schuld, wenn du so viele Kinder machst« »Wieso: die hat Allah gemacht!« »Wie, du bist Allah?« »In Europa regnet es Geld, du willst nur nichts davon abgeben« »Ihr seid Rassisten: ihr wollt nur soviel, weil ich weiß bin« »les blancs sont la pour payer« (»Die Weißen sind da zum Zahlen« – sozusagen ihre einzige Daseinsberechtigung), »Meine Freundin wird euch verfluchen« – und so weiter und so fort.
Wichtig ist das Geld sichtbar zu machen, also irgendwann den zweiten 5000er danebenzulegen und immer wieder drauf zu tippen. Jegliche Versuche der anderen, den Brocken einfach in deine Tasche zu schieben, abwehren, bis die andere Seite bei 12 500 angekommen ist. Wenn du danach noch weiter runter willst, musst du überzeugend aufstehen und gehen. Dann ist es fast sicher, dass der Verkäufer kurz darauf dir nachläuft und wortlos den Brocken in deine Tasche schiebt und angeekelt die 10 000 in Empfang nimmt.
Danach wird dann wieder öffentlich gebetet.