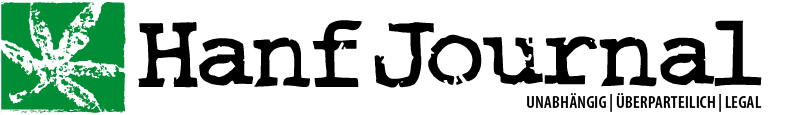Zwar handelten die Taliban im Sinne des UN-Einheitsabkommens über Betäubungsmittel, aber das ohne die Erlaubnis der USA, die sich nicht die Butter von Brot nehmen lassen.
Autor: Sadhu Van Hemp
Es ist vollbracht: Deutschland hat seine Freiheit am Hindukush erfolgreich verteidigt. Zehn Jahre lang durfte die Bundeswehr unter dem Oberbefehl der USA mitwirken, Afghanistan mittels der „Operation Enduring Freedom“ zu zivilisieren. Nun checken unsere Soldaten aus, mit dem schönen Gefühl, die Afghanen für alle Zeit von Terror und Drogenanbau kuriert zu haben.
So seltsam es klingt: Die Afghanen verehren und mögen die Deutschen, schließlich pflegen beide Länder seit Kaisers Zeiten nachhaltige bilaterale Beziehungen. Anstoß dafür war die im 19. Jahrhundert erwachte Schwärmerei der Deutschen für den Zauber der orientalischen Welt, die es fortan zu erforschen – und auch zu erobern galt. Doch im Gegensatz zu britischer und französischer Kolonialpolitik, die auf Territorialgewinn zielte, beschränkte sich der verspätete deutsche Imperialismus auf wirtschaftliche Interessen, die ohne Pulverdampf durchgesetzt wurden. Erster Empfänger deutscher Wohltaten war der „Kranke Mann am Bosporus“, dem Kaiser Wilhelm II. die Bagdadbahn schenkte, mit dem Ziel, den Wirtschaftsraum bis zum Persischen Golf zu erschließen und einen Stützpunkt für die Handels- und Kriegsflotte zu schaffen. In dieser Zeit kamen auch die ersten Deutschen ins Königreich am Hindukush – als Zuschauer des „Trauerspiels von Afghanistan“, das die britische Armee inszenierte. Der Romancier und Journalist Theodor Fontane hielt in gleichnamigem Gedicht das britische Kriegsdebakel mit den Worten fest: „Mit dreizehntausend (Mann) der Zug begann. Einer kam heim aus Afghanistan.“
König Amanullah war es dann, der nach sechzig Jahren britischer Gewaltherrschaft anno 1919 damit drohte, sich notfalls zur Beendigung des Blutvergießens mit dem ebenso verhassten Russischen Reich zu verbrüdern. Die Chancen auf einen vorzeitigen Zweiten Weltkrieg standen nicht schlecht, doch die leere Kriegskasse der Briten gab es nicht her, die ungeheure logistische Herausforderung eines Stellungskrieges samt Materialschlacht im hinteren Orient zu bewerkstelligen. So kam es zu dem Deal, Afghanistan in die Unabhängigkeit zu entlassen und als Pufferzone zwischen britischer und russischer Expansionspolitik einzurichten. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte – vorneweg das Deutsche Reich, das sich keineswegs nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg geläutert zeigte – wohl aber cleverer als die Konkurrenz. Statt Reiter mit Säbel und Muskete ritten Ingenieure mit Hammer und Zirkel, Lehrer und Gelehrte ein, die König Amanullah zu ehrgeizigen Plänen der Modernisierung des Landes anstifteten. 1924 öffnete in Kabul die Amani-Oberrealschule ihre Pforten, und das afghanisch-deutsche Schulabkommen von 1928 ermöglichte, dass auch afghanische Abiturienten an preußischen Universitäten studieren konnten. 1936 folgte die „Deutsche Schule Kabul“, und 1937 wurde das „Technikum“ gegründet, an der junge Afghanen von deutschen Paukern in technischen Berufen ausgebildet wurden. Die Entwicklungshelfer aus dem fernen Teutonenland haben in jenen Jahren deutliche Spuren in den Herzen der Afghanen hinterlassen. Das tolerante Kabul war bis Anfang der Vierziger Jahre ein El Dorado für deutsche Gastarbeiter, die sich in schicken Nachtbars das Heimweh ins Dritte Reich damit vertrieben, sich von orientalischen Schönheiten mit süßen Früchten und berauschenden Köstlichkeiten verwöhnen zu lassen.
Nun kam die Liebe der Deutschen zum hinteren Orient nicht von ungefähr. Insbesondere die Nazis hatten ihre helle Freude an den „schönen blauen Augen“ der Paschtunen, die obendrein der indogermanischen Sprachfamilie angehören. Dieses ethnologische Vorurteil erklärt das eifrige Engagement der Nazis in Afghanistan. Der vom Rassenwahn besessene Massenmörder Heinrich Himmler sah in den Völkern des Himalaya-Gebietes sogar Nachfahren eines göttergleichen Herrenmenschen, die als enge Verwandte des Ur-Germanen als Beweis dafür herhalten sollten, dass der erste Mensch der Menschheit ein Übermensch aus Deppendorf bei Bielefeld war, der bereits vor Adams Zeiten seine Gene auf dem Dach der Welt verkleckerte.
1941 war dann Schluss mit dem süßen Leben in Kabul. Die deutsche Kolonie wurde zum Schutz vor den Engländern zur Grenze eskortiert und abgeschoben. Was blieb, war die Erinnerung der Afghanen an fleißige, pflichtbewusste und gebildete Deutsche, die den Kindern Lesen und Schreiben beigebracht und die Wege nicht mit Leichen gepflastert hatten.
Dieser gute Ruf sollte anno 1967 der nächsten in den Orient pilgernden Generation zugutekommen. Diesmal waren es aber keine Baumeister und Pädagogen, die sich nach getaner Arbeit in den Opiumhöhlen der Chicken Street verloren. Nunmehr setzte sich kein gepflegter Deutscher auf den Stuhl des Schuhputzers, sondern der langhaarige Gammler aus gutbürgerlichem Hause, dem die Sackläuse bereits in den Augenbrauen saßen. Die Invasion der Hippies aus Westeuropa und den USA schockierte die Afghanen jedoch nur insofern, wie leicht sich harte Dollars mit dem Handel von psychoaktiven Substanzen verdienen lassen. Bis zum Einmarsch der Roten Armee anno 1979 war Afghanistan das Drogen-Mekka schlechthin, und wenn es Tote zu beklagen gab, dann waren das hängen gebliebene Junkies aus dem wesentlichen Kulturkreis, um die keine afghanische Mutter trauern musste.
Doch das sollte sich bald ändern und den Afghanen selbst zum Verhängnis werden. Mit dem Bürgerkrieg von 1978 und der anschließenden Intervention der Sowjetunion wurde die Uhr zurückgedreht: Der Hippietrail machte fortan einen großen Bogen um das Land, das zum Spielball der Supermächte im Kalten Krieg geworden war und komplett verelendete. Dank tatkräftiger Unterstützung der USA und den NATO-Verbündeten gewann der Opiumanbau in Afghanistan die Bedeutung, die er heute – 35 Jahre später – noch immer hat. Zum einen war Opium die Geldquelle für Waffenkäufe, zum anderen stärkte es die fanatisierten Kämpfer der Mudschahidin und schwächte die ungläubigen Kollegen auf russischer Seite. Nach 15.000 gefallenen Rotarmisten zog die Sowjetunion 1989 die Reißleine und kapitulierte vor der Übermacht der Mudschahidin-Partisanen. Die Bilanz dieses Betriebsausflugs der Roten Armee beläuft sich auf anderthalb Millionen Tote und fünf Millionen Flüchtlinge auf afghanischer Seite. Anfang der Neunziger Jahre prägten Invalide und abgerissene Junkies das Stadtbild von Kabul, und für Ordnung sorgte das Faustrecht.
1996 machte die „Islamische Talibanbewegung“ dem Sodom und Gomorrha am Hindukush ein Ende und installierte einen Gottesstaat nach dem Vorbild des Iran. Erste Amtshandlung der Fundamentalisten war, dem Opium- und Haschischhandel den Krieg zu erklären, was binnen kürzester Zeit verheerende Kursschwankungen auf den internationalen Drogenmarkt nach sich zog. Zwar handelten die Taliban im Sinne des UN-Einheitsabkommens über Betäubungsmittel, aber das ohne Erlaubnis der USA, die das Oberkommando im Anti-Drogen-Krieg haben und sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, was die Regulierung des Weltmarktes betrifft. Bis 2001 dauerte der Spuk brennender Felder, dann war Schluss mit dem Amoklauf der Gotteskrieger: Die USA traten in die Fußstapfen der UdSSR, und seitdem stehen die Schlafmohn- und Hanffelder unter Aufsicht der ISAF-Truppen in voller Blütenpracht. Afghanistan ist längst wieder Exportweltmeister in Sachen Dope: 90 Prozent allen Rohopiums werden am Hindukusch gewonnen, und das UN-Büro für Drogen- und Kriminalitätsbekämpfung (UNODC) gab im September bekannt, dass 2012 rund 1400 Tonnen Haschisch geknetet wurden, was einer Zuwachsrate von acht Prozent zum Vorjahr ergibt. Pro Hektar verdienten die Hanfbauern rund 6400 Dollar, also 1800 Talerchen mehr als für den Anbau von Schlafmohn.
Unter diesem Aspekt hat sich der Kriegsbeteiligung der Bundeswehr in Afghanistan gelohnt, so zynisch das auch klingen mag. Der Nachschub mit „Schwarzen Afghanen“ für die Bongs der Welt ist vorläufig gesichert, die Bundeswehr durfte zehn Jahre lang unter realen Bedingungen die Kriegskunst üben, und deutsche Waffenschmieden durften weltweite Reklame schieben. Dass der Einsatz zum „Wiederaufbau der Infrastruktur in Afghanistan“ jährlich rund eine Milliarde Steuergelder geschluckt und fast 60 deutschen Soldaten das Leben gekostet hat, ist dagegen nur als marginal zu betrachten – denn wo gehobelt wird, da fallen auch Späne – wie schon der olle Clausewitz sagte.
In diesem Sinne wollen wir allen Beteiligten dieses humanitären ISAF-Mandats im hinteren Orient danken. Vor allem dem Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière, der zur feierlichen Übergabe des Schlüssels für das Hochsicherheitscamp in Kundus extra angereist war und die Nachmieter der Trutzburg mit den Worten aufmunterte: „Ich wünsche unseren afghanischen Partnern Mut, Kraft und auch Geduld, damit sie ihre schwierige Aufgabe gut meistern werden, damit die Ernte gut wird.“